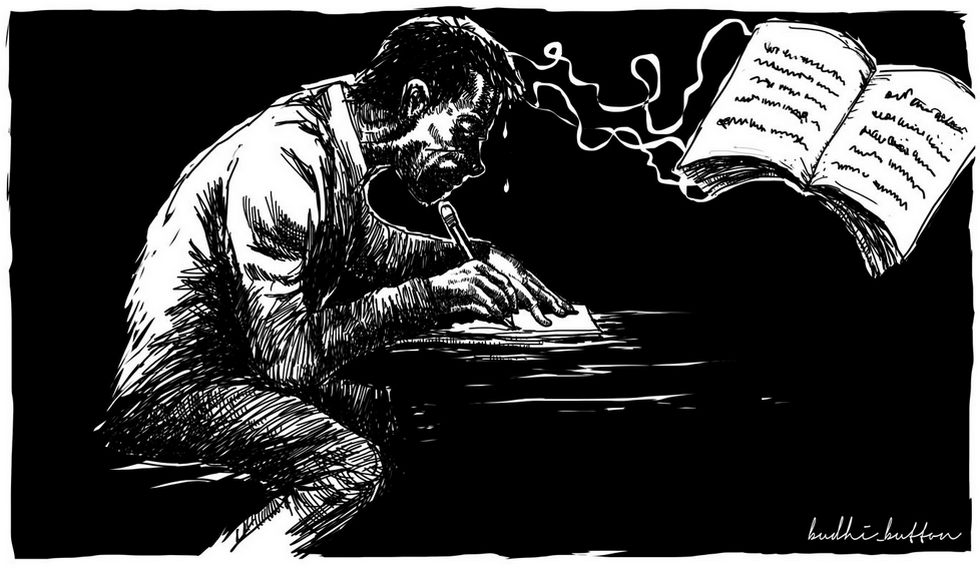Mir sind jene Geschichten lieb, in denen jemand nach seiner verlorenen Vergangenheit sucht. Herausgefunden habe ich diese Vorliebe für diese spezielle Form der Queste, als ich vor Jahrzehnten Tabucchis Indisches Nachstück las. Es war mir stets ein Ereignis, von einer melancholischen Vergesslichkeit zu träumen, die unmittelbar auf die Vergänglichkeit verweist.
Es mag wohl daran liegen, dass sich hinter meinem Rücken selbst viele Rätsel aufgestaut haben. So gibt es zum Beispiel eine Fotografie, die sich in meinem Besitz befindet, auf der ein in den 1960er Jahren junger Mann zu sehen ist, wie er neben meiner damals ebenfalls jungen und unverheirateten Mutter steht; leicht versetzt zu ihr hakt er sich mit der einen Hand bei ihr ein (die andere ist nicht zu sehen) und könnte sie sogar am Fallen gehindert haben, denn sie deutet einen Ausfallschritt an. Das wäre an sich nichts Ungewöhnliches, wenn nur überhaupt jemand wüsste, wer dieser Bursche ist. Es soll sich wohl um einen ihrer Verehrer gehandelt haben, aber wodurch ließ er sich vertreiben? Diese Frage ist eine Kleinigkeit innerhalb der Fakten der Zeit, die empfindlich auf nur die kleinsten Impulse reagiert; größer ist sie, wenn sie die Wahrscheinlichkeit meiner Existenz berührt. Die Idee, dass ich ein anderer hätte sein könne, macht mich schaudern, aber nur deshalb, weil es dieses Foto gibt und ich es habe, denn alle, die es betrifft, sind tot und wussten zu Lebzeiten kaum etwas von seiner Existenz. Ich halte den Augenblick einer Unmöglichkeit in der Hand, der ich kaum weiter nachspüren kann.
Während ich nachts auf dem Kackbecken hockte und las, hörte ich den Wind durch die Rohre nach oben durch den Abfluss granteln. Es hörte sich in etwa so an, als ob ein Elefant ein Zelt anbläst, dessen feine Wände zu flattern beginnen.