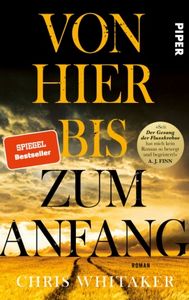Zum 80-jährigen Jubiläum begann der Diogenes-Verlag 2019 die Raymond Chandlers Klassiker in einer neuen Übersetzung herauszugeben. Nachdem ich mir das Buch einmal angesehen hatte, das von Frank Heibert neu übersetzt wurde, tendiere ich doch eindeutig zu der Übersetzung von Gunar Ortlepp, die 1974 erschien.
Raymond Chandler sagte einmal, er sei der erste gewesen, der auf realistische Weise über Los Angeles geschrieben habe. Um über einen Ort zu schreiben, sagte er, müsse man ihn lieben oder hassen, oder beides, abwechselnd, so wie man eine Frau liebt. Leere und Langeweile waren zwecklos. L. A. hat ihn nie gelangweilt. Er fand es vielleicht banal, aber niemals leer. Er liebte es (als er 1912 ankam) und hasste es (als er 1946 abreiste), bis es schließlich, wie er sagte, für ihn eine müde alte Hure geworden war. Er hat diese Stadt besser als jeder andere verstanden, ihren Rhythmus und ihre Grobheit, ihre Tankstellen, die verschwenderisch mit Licht gefüllt sind, die Häuser in den Schluchten, die in der Schwärze hängen, den Geruch der Luft, das Gefühl der Winde, den Puls des Ortes, weshalb seine Romane zu keiner Zeit veraltet wirken: Er hat die Essenz der Stadt eingefangen, nicht nur ihre zeitliche Oberfläche.