Die Turbulenzen nahmen zu, ohne Reue,
uns über die Zeiten hinwegzufegen. Ich sah,
wie alles erstarrte – ein handfest gewordener
Untergang, ein Zerbröseln am Nullpunkt,
der von einem Geschwader Minuswelten
umschwärmt wurde, die dem Werden
nicht entkommen können.
Minuswelten
Zur Bibliothek
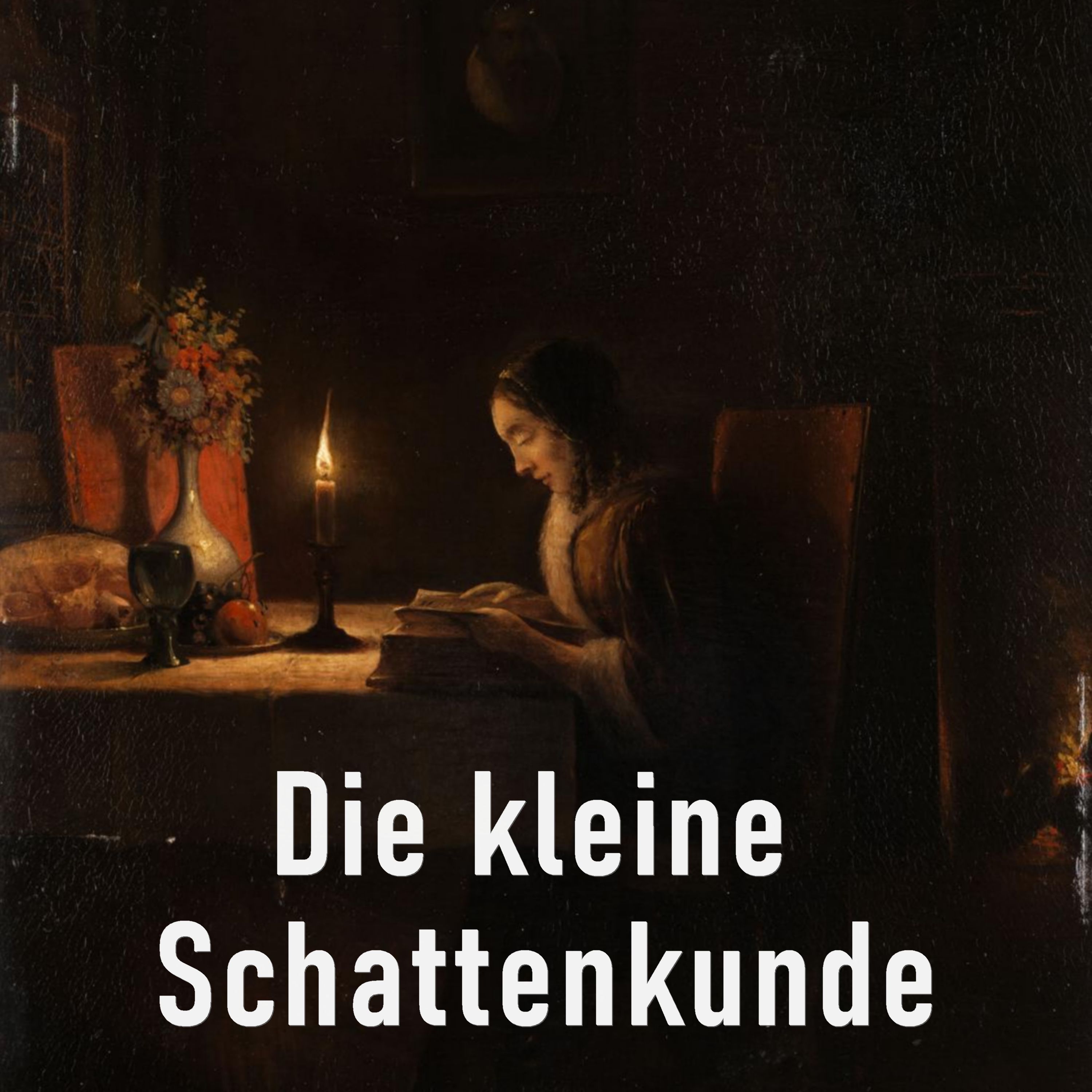
Die kleine Schattenkunde
Die kleine Schattenkunde ist ein literarischer Werkstatt-Podcast. Jede Folge führt zu einem anderen Text: Skizzen, Fragmente, seltsame Beobachtungen und fertig gelesene Passagen. Nur der Prozess des Erzählens und die Geschichten, die an den Rändern des Gewöhnlichen entstehen. Für alle, die das Unbestimmte lieben.
#06 Zur Bibliothek
Um die besonderen Bücher zu finden, insofern man sie nicht bereits in seiner Sammlung hat, ist es unabdingbar, immer weiter den Spuren zu folgen. Früher war es so, dass man dem Literaturverzeichnis folgte und sich die nächsten Stationen heraus schrieb. Des weiteren fand man – gerade in Taschenbüchern – am Ende ein reichhaltiges Register oder sogar Werbung für ähnliche Werke wie dieses, das man gerade in Hände hielt. Das bedeutet nicht, dass es heute nicht ähnlich funktioniert, aber die Trefferquote ist doch längst nicht mehr so hoch wie zu Beginn eines Leselebens, aber die Spurensuche funktioniert weiterhin überragend bei Sachbüchern, die sich sozusagen per definitionem aus angegebenen Quellen speisen.
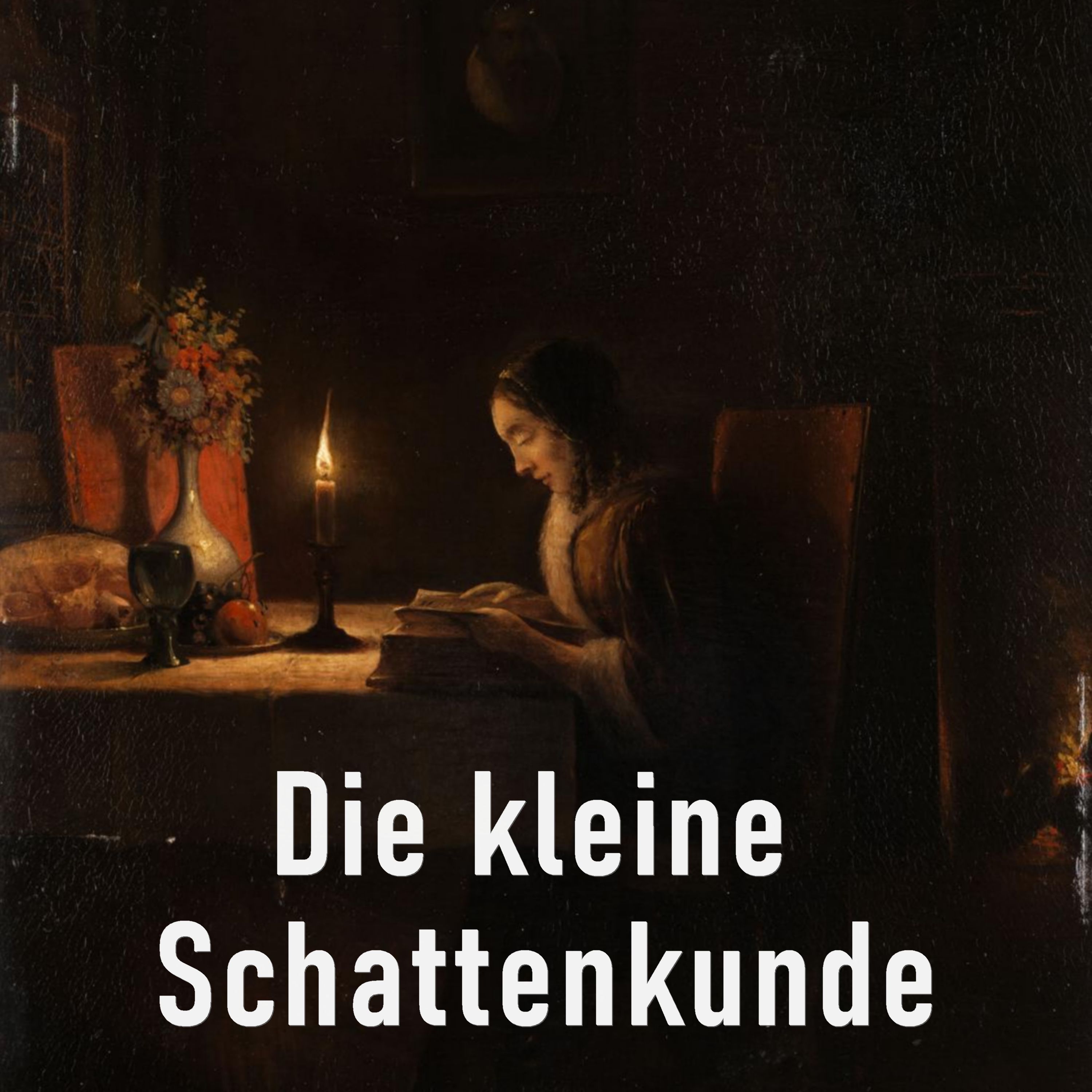
Um die besonderen Bücher zu finden, insofern man sie nicht bereits in seiner Sammlung hat, ist es unabdingbar, immer weiter den Spuren zu folgen. Früher war es so, dass man dem Literaturverzeichnis folgte und sich die nächsten Stationen heraus schrieb. Des weiteren fand man – gerade in Taschenbüchern – am Ende ein reichhaltiges Register oder sogar Werbung für ähnliche Werke wie dieses, das man gerade in Hände hielt. Das bedeutet nicht, dass es heute nicht ähnlich funktioniert, aber die Trefferquote ist doch längst nicht mehr so hoch wie zu Beginn eines Leselebens, aber die Spurensuche funktioniert weiterhin überragend bei Sachbüchern, die sich sozusagen per definitionem aus angegebenen Quellen speisen.

Überlegt man sich, wie eine ausgewachsene und nennenswerte Bibliothek überhaupt zustande kommt, dann wird man zugeben müssen, dass – abgesehen vom Grundstock, den jede Bibliothek pflegen sollte, unabhängig davon, in welchen Zweig hinein sie sich später entwickelt – ein Großteil der Anschaffungen zunächst ungelesen eingeordnet wird. Man beginnt ein vielversprechendes Werk und legt es enttäuscht zur Seite, um zum nächsten Buch zu greifen. Manchmal kommt es sogar vor, das im gesamten Pulk nicht das zu finden ist, nach dem man gerade dürstet und schon mit der nächsten Bestellung zugange ist. Selbstverständlich hat man immer etwas zu lesen, es ist ganz und gar unmöglich, leer zu laufen, aber ich spreche hier von besonderen Büchern, von jenen, die sofort in den persönlichen Kanon wandern. Um so mehr Bücher auf den Markt geworfen werden, desto geringer werden die Meisterwerke, desto höher aber auch die Sichtungen, die dann den Umfang der Bibliothek merklich erhöhen.
Die Inszenierung des Unbewussten: Juan Carlos Onettis „Ein verwirklichter Traum“ (Un sueño realizado).

Juan Carlos Onettis Erzählung „Ein verwirklichter Traum” (1941) zählt zu den rätselhaftesten und atmosphärisch dichtesten Kurzgeschichten der lateinamerikanischen Literatur. In dieser meisterhaft komponierten Erzählung verschwimmen die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit, Theater und Leben, bis sie vollständig verwischen. Die Geschichte einer namenlosen Frau, die den gescheiterten Theaterunternehmer Langman beauftragt, ihren Traum auf der Bühne zu inszenieren, wird zu einer tiefsinnigen Meditation über Sehnsucht, Selbsterkenntnis und Tod.
Langman, ein heruntergekommener Theaterdirektor, der in einer heißen Provinzstadt gestrandet ist, erzählt die Geschichte selbst. Eine mysteriöse Frau in Schwarz sucht ihn auf und hat ein ungewöhnliches Anliegen: Sie möchte ein kurzes Theaterstück aufführen – allerdings nicht vor Publikum, sondern nur für sich selbst. Das Stück, das sie „Ein verwirklichter Traum“ nennt, basiert auf einem Traum, der ihr einst ein Gefühl intensiven Glücks vermittelt hat, dessen Bedeutung sie jedoch nicht versteht.
Warum wir Geschichten wieder und wieder erzählen
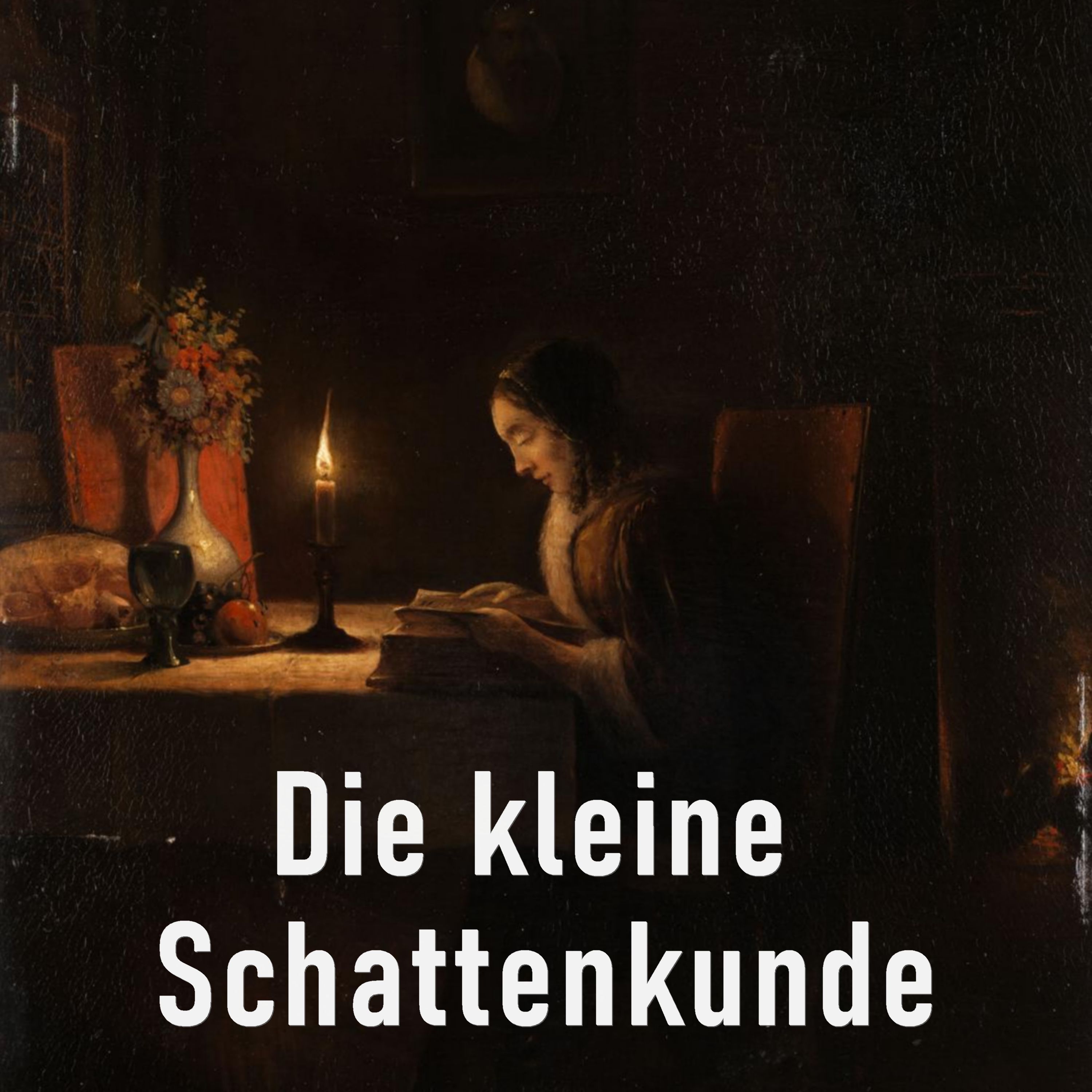
Die kleine Schattenkunde
Die kleine Schattenkunde ist ein literarischer Werkstatt-Podcast. Jede Folge führt zu einem anderen Text: Skizzen, Fragmente, seltsame Beobachtungen und fertig gelesene Passagen. Nur der Prozess des Erzählens und die Geschichten, die an den Rändern des Gewöhnlichen entstehen. Für alle, die das Unbestimmte lieben.
#05 Warum wir Geschichten wieder und wieder erzählen
Im Laufe der Zeit hat die Menschheit immer wieder die gleichen grundlegenden Geschichten erzählt. Von den antiken Mythen bis zum modernen Kino folgen die Erzählungen oft vertrauten Strukturen, wie die Reise des Helden, die Tragödie der Hybris oder der Triumph der Liebe über alle Widrigkeiten. Doch trotz dieser Wiederholungen haben diese Geschichten eine große Anziehungskraft und offenbaren mit jeder neuen Erzählung neue Dimensionen. Dieses Phänomen lässt sich auf drei zentrale Faktoren zurückführen: die Universalität menschlicher Erfahrungen, die Anpassungsfähigkeit von Geschichten an sich verändernde Kontexte und die vielschichtige Komplexität, die dem Erzählen von Geschichten innewohnt.
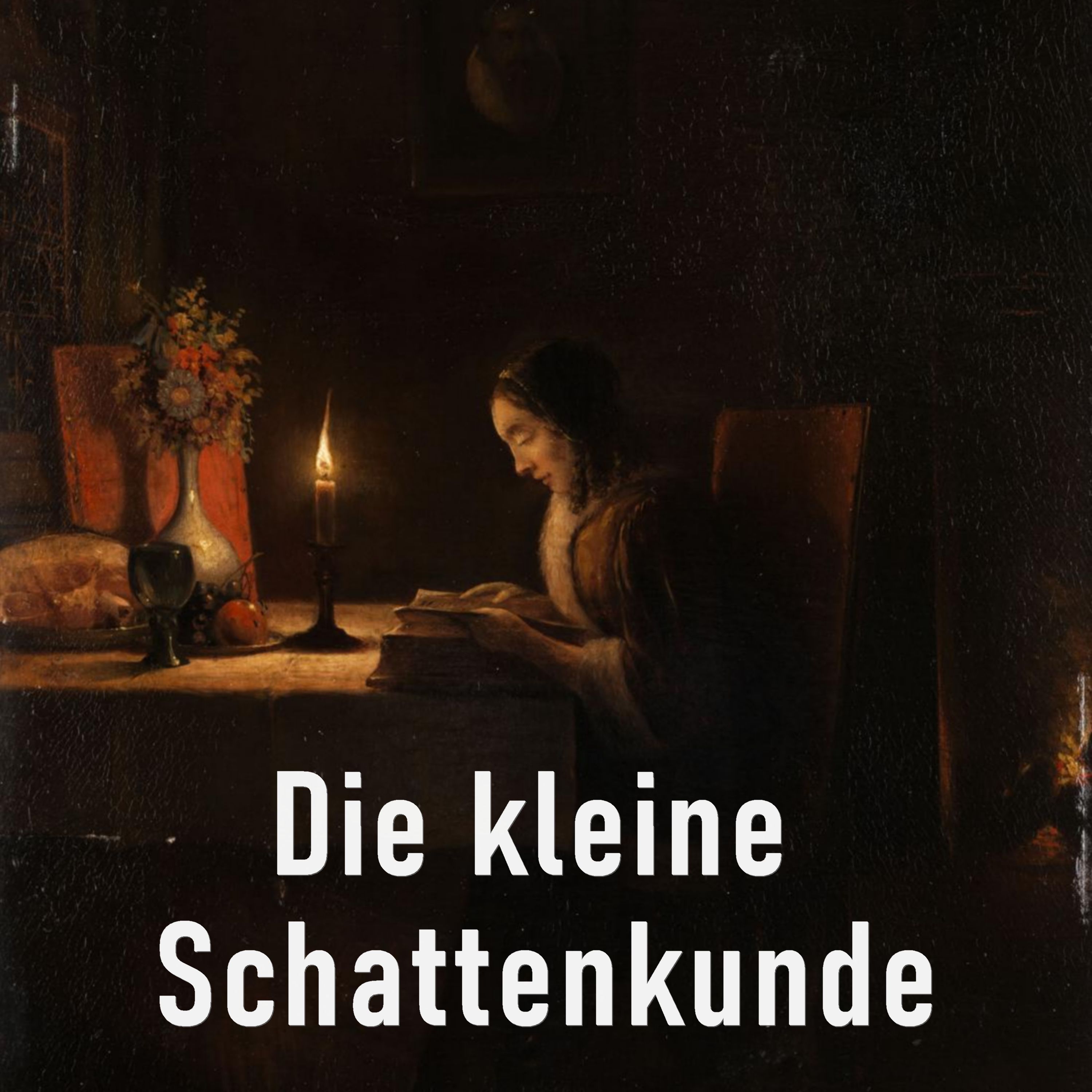
Im Laufe der Zeit hat die Menschheit immer wieder die gleichen grundlegenden Geschichten erzählt. Von den antiken Mythen bis zum modernen Kino folgen die Erzählungen oft vertrauten Strukturen, wie die Reise des Helden, die Tragödie der Hybris oder der Triumph der Liebe über alle Widrigkeiten. Doch trotz dieser Wiederholungen haben diese Geschichten eine große Anziehungskraft und offenbaren mit jeder neuen Erzählung neue Dimensionen. Dieses Phänomen lässt sich auf drei zentrale Faktoren zurückführen: die Universalität menschlicher Erfahrungen, die Anpassungsfähigkeit von Geschichten an sich verändernde Kontexte und die vielschichtige Komplexität, die dem Erzählen von Geschichten innewohnt.

Im Herzen jeder Geschichte, die Bestand hat, spiegelt sich der Zustand des Menschen wider. Themen wie Liebe, Angst, Ehrgeiz und Sterblichkeit sind nicht an Kultur oder Zeit gebunden; sie sind der menschlichen Erfahrung inhärent. Carl Jungs Konzept der Archetypen – universelle Symbole und Motive, die im kollektiven Unbewussten eingebettet sind – bietet einen Rahmen, um zu verstehen, warum sich bestimmte Geschichten ewig anfühlen. Archetypen wie der Held, der Mentor, der Schatten und der Betrüger kommen immer wieder vor, weil sie grundlegende Aspekte unserer Psyche widerspiegeln.
Die Geschichte eines Helden, der sich ins Unbekannte wagt, Prüfungen besteht und verändert zurückkehrt, ist in allen Kulturen allgegenwärtig. Von Odysseus in Homers Odyssee bis zu Luke Skywalker in Star Wars spricht diese Erzählstruktur zu unseren eigenen Reisen des Wachstums und der Selbstentdeckung. Die Wiederholung dieser Themen unterstreicht ihre Relevanz; wir erzählen diese Geschichten immer wieder, weil sie Wahrheiten zum Ausdruck bringen, die konstant bleiben, auch wenn sich die Welt weiterentwickelt.
Das Manuskript in der Flasche: Über Edgar Allan Poes Poetik der Auslöschung
Die wohl bekannteste Daguerreotypie von Edgar Poe ist die sogenannte Ultima Thule vom 9. November 1848, die vier Tage nach seinem Selbstmordversuch entstand. Dieses Porträt wurde nach einem Zitat aus Poes Gedicht Traumland so genannt, weil man darin einen Ausdruck trotziger Verzweiflung am Rande des Todes gesehen haben will. Für die meisten Poe-Liebhaber ist dies das Bild, das dem Charakter seines Werkes am nächsten kommt – ein Antlitz, das bereits jenseits seiner selbst zu existieren scheint, ein Gesicht am Abgrund.
Baudelaire attestierte dem Porträt, dass Poe hier ein sehr französisches Aussehen zeige; in Wirklichkeit war der Dichter vom Alkohol gezeichnet. Das ursprünglich eher feminine Gesicht weist tiefe Furchen auf, die Augenpartien zeichnen sich asymmetrisch ab. Es ist, als hätte sich das Leben selbst in diese Züge eingeschrieben, als wären die inneren Labyrinthe, durch die Poes Geist wanderte, nun nach außen gekehrt und in Fleisch verwandelt.
Doch dann geschieht etwas Merkwürdiges in einem Leben voller Merkwürdigkeiten. Am 13. November, also vier Tage später, sieht Poe schon viel erholter aus. Zu sehen auf dem als Daguerreotypie bezeichneten Porträt von Whitman. Die Verwandlung ist so dramatisch, dass man kaum glauben mag, es handele sich um denselben Menschen. War es die Elastizität der Jugend – Poe war damals erst neununddreißig –, oder war es jene merkwürdige Fähigkeit zur Regeneration, die manche Menschen besitzen, die gewohnt sind, sich immer wieder aus den eigenen Abgründen emporzuziehen?
1849 scheint Poe fast wieder gesund zu sein. Er sieht gesund aus, hat Pläne für die Zukunft, will sogar wieder heiraten – und stirbt unter mysteriösen Umständen in Baltimore, unter dessen Sternen sich sein ganzes düsteres und tragisches Leben abgespielt hatte. Der Tod kam in Form einer Auslöschung: gefunden in fremder Kleidung, delirierend, unfähig zu erklären, was geschehen war. Es war, als hätte das Leben selbst eines seiner Manuskripte geschrieben und es dann ins Meer der Vergessenheit geworfen.
Im anständigen Teil der Stadt
Sie drehte sich um und beobachtete, wie der Fremde an ihr vorbei ging,
fragte sich, was ihm zugestoßen sein mochte. Im anständigen Teil
der Stadt beteten sie die Wirklichkeit an. Es brannte nicht mehr, als er
einige Stunden später erwachte.
Die Türen zu allen Geschäften standen offen, manche wie ein Schlund,
eingeschlagen und marode. Im anständigen Teil der Stadt
brachten sie sich zu Anlässen gegenseitig Kuchen. Aus den Kesseln
unter der Stadt dampften Wassersignale.
Die Vehikel schlurften durch die Straßen, obszöne Jäger emsiger Flaneure,
die jeden Tag nur einen kleinen Bissen dieser phänomenalen Aussicht
zu sich nahmen. Im anständigen Teil der Stadt
gab es Prospekte, die alles aus der Ferne zeigten.
Die entblößten Träume
Ich bin auf der Suche nach dem Seltsamen.
Das Leben, die entblößten Träume…
oder mehr noch : der fehlende Sinn, der nur dann fehlt, wenn er wirklich fehlt
und nicht etwa wenn es ihn gar nicht gibt.
Dieser Baustein, der beweisen könnte
dass die Schöpfung eine runde Sache ist, alles
eingerastet und läuft wie geschmiert, wir haben
die Vernunft doch tatsächlich als solche erkannt, hurra.
Die Gebäude und Räume können nur von einer Seite aus betreten werden,
eine Auswahl fällt daher leicht. Im Innern aber
stecken die Möglichkeiten
einer ausgedehnten Traumwanderung, die
– wie eine gute Geschichte – irgendwo anfängt
und irgendwo aufhört. Das Vorher und Nachher ist nur
als Potenz vorhanden, aber es wiegt schwer
in seiner Nichtausgesprochenheit.
Das Leben, die entblößten Träume…
Das Seltsame hat einen anderen Grund als das Gewöhnliche zu konterkarieren,
es führt seinen Tanz in Stille aus und ist
präsent wie ein Bild, das von einer ruchlosen Hand
überpinselt wurde, in der Annahme, niemand würde kratzen
oder schaben oder sich fragen, warum die Farbe
derart monströs aufgetragen wurde,
ob sich da nicht ein Geheimnis finden ließ bei der Entscheidung :
Welches der beiden Kunstwerke soll dem Vergessen
in den Rachen geworfen werden? – von denen eins vielmehr
ein quasi-Kunstwerk ist, mit einem quasi-Dasein.
Zerstören wir das Sichtbare für etwas, das wir nicht kennen –
und wäre ein Vergleich nicht ohnehin töricht? Eine Skizze
ist der erste Beleg für die Dauer,
denn solange immer alles möglich ist,
vergeht kein Gedanke ungedacht.

