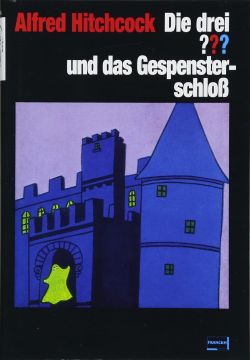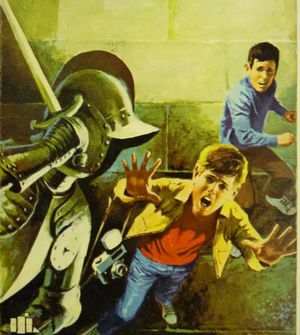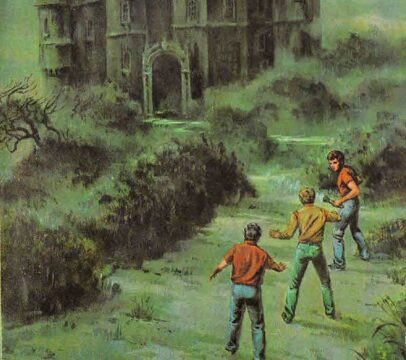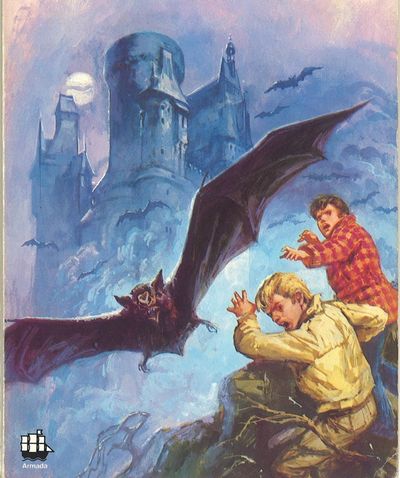Megan Miranda ist eine feste Größe im Thriller-Geschäft. Erst im letzten Jahr hatten wir mit „Der Pfad“ einen atmosphärischen Thriller, der sich in den Appalachen abspielte. Mit „Sieben Stunden“, der im Original mit „The Only Survivors“ wieder einmal besser transportiert, was im Roman passiert, haben wir diesmal einen psychologischen Thriller vor uns, der nicht nur als fesselndes Mysterium funktioniert, sondern auch als komplexe Untersuchung von Trauma, Schuld und der Zerbrechlichkeit der menschlichen Erinnerung. In ihrem unverkennbaren Stil webt Miranda eine Geschichte in zwei Zeitebenen, die den Leser zwingt, sich an der Seite der Protagonistin Cassidy Bent durch Vergangenheit und Gegenwart zu bewegen. Was dabei herauskommt, ist weniger ein konventioneller Kriminalroman als vielmehr eine tiefgründige Meditation über das Überleben an sich – sowohl über den buchstäblichen Akt, eine Katastrophe zu überstehen, als auch über die psychologischen Kosten des Überlebens anderer.
Eine der größten Stärken des Romans ist seine strukturelle Komplexität. Miranda arbeitet mit wechselnden Zeitebenen, wobei sie zwischen dem Treffen im Strandhaus in der Gegenwart und Rückblenden auf den tragischen Unfall zehn Jahre zuvor wechselt. Diese bruchstückhafte Erzählweise baut nicht nur Spannung auf, sondern dient auch als Erkundung, wie ein Trauma die Wahrnehmung verzerrt.
Cassidy, die im Mittelpunkt des Romans steht, ist die unzuverlässige Erzählerin par excellence – nicht im Sinne einer offensichtlichen Lüge, sondern in der Art und Weise, wie sie darum kämpft, ihre Erinnerungen mit der Realität in Einklang zu bringen. Indem Miranda die Ereignisse durch ihre Perspektive filtert, lässt sie den Leser an der instabilen Psychologie einer Überlebenden teilhaben, die sowohl Opfer als auch mögliche Verschwörerin ist. Sie spiegelt die Unzuverlässigkeit eines kollektiven Traumas wider, in dem die gemeinsame Erinnerung ebenso sehr von Auslassungen und Verdrängungen wie von Fakten geprägt ist.
Die nichtlineare Erzählweise unterläuft natürlich auch die Erwartungen des Lesers. Während Thriller in der Regel auf eine finale Enthüllung angewiesen sind, die frühere Ereignisse in einen neuen Kontext stellt, bietet dieser Roman eine schleichendere Wahrheit: Es gibt keinen einzigen Moment der Erkenntnis, sondern nur eine allmähliche Entlarvung der Selbsttäuschung. Miranda zwingt ihre Figuren – und damit auch ihre Leser -, sich mit der unangenehmen Vorstellung auseinanderzusetzen, dass das Überleben selbst ein moralisch ambivalenter Akt ist.
Jedes Mitglied der immer kleiner werdenden Gruppe von Überlebenden verkörpert eine andere psychologische Reaktion auf das Trauma, so dass ihre Interaktionen von Paranoia und Spannung geprägt sind. Cassidy verkörpert die Vermeidung und versucht, die Verbindung zur Gruppe abzubrechen, bis sie durch Ians Tod wieder in die Gruppe hineingezogen wird. Andere, wie Amaya, setzen auf Kontrolle als Bewältigungsmechanismus und organisieren die jährlichen Treffen, als ob die Aufrechterhaltung der Struktur das Chaos in Schach halten würde. Grace hingegen spielt die Rolle der Friedensstifterin und klammert sich an eine Scheinharmonie, die die darunter liegenden Brüche ignoriert.
Diese psychologischen Profile spiegeln die klassischen Reaktionen auf ein Trauma wider – Kampf, Flucht und Schwäche -, was Mirandas akribische Herangehensweise an die Psychologie der Charaktere unterstreicht. Ihre gemeinsame Vergangenheit verbindet sie, doch anstatt Trost zu spenden, wirkt sie wie ein Käfig. Das Strandhaus, das normalerweise mit Entspannung und Flucht assoziiert wird, verwandelt sich in eine Arena der Klaustrophobie, in der alte Wunden wieder aufbrechen. Mirandas größter Triumph ist hier ihre Fähigkeit zu zeigen, wie die Überlebenden statt Dankbarkeit oft Schuldgefühle empfinden, die sich in einer toxischen Gruppendynamik manifestieren.
Darin ist Cassidys eigene Handlung besonders überzeugend. Sie ist keine klassische Krimiheldin, die aktiv ein Rätsel löst, sondern vielmehr gezwungen wird, sich selbst in Frage zu stellen. Sie ist gefangen zwischen der moralischen Gewissheit der Vergangenheit und der zwiespältigen Realität der Gegenwart. Am Ende des Romans hat sich ihr Verständnis des Unfalls – und ihrer Rolle darin – verändert, was Mirandas größeres thematisches Anliegen widerspiegelt: die Erinnerung als Beschützerin und Betrügerin zugleich.
Die Schuld des Überlebenden und die Bürde des Geheimnisses
Der Roman hat mehrere thematische Ebenen, wobei die Schuld der Überlebenden die wichtigste ist. Miranda hinterfragt die vereinfachte Vorstellung, dass das Überleben einer Katastrophe an sich positiv ist. Stattdessen untersucht sie, wie das Erleben eines Traumas zu einer anderen Art von Belastung werden kann, insbesondere wenn das Überleben mit moralischen Kompromissen verbunden ist.
Die jährlichen Treffen, die angeblich der Ehrung der Toten dienen, sind Rituale der Selbstbestrafung. Das Beharren der Gruppe auf Geheimhaltung dient nicht nur der Vermeidung von Konsequenzen, sondern ist ein Versuch, die Kontrolle über die gemeinsame Erzählung zu behalten. Der Begriff der „Wahrheit“ ist in diesem Roman fließend; was die Figuren erinnern, ist oft weniger wichtig als das, was sie glauben müssen, um mit sich selbst überhaupt leben zu können.
Jeder Überlebende hat sich auf seine Weise durch den Unfall definiert, ob er es zugibt oder nicht. Das gilt auch für Cassidy, die einen Großteil des Romans in dem Glauben verbringt, sich von der Vergangenheit lösen zu können, um dann festzustellen, dass ihr ständiges Ausweichen ihre eigene Form der Verstrickung ist.
Der Strand als Grenzraum
Das Strandhaus dient hier als physische Repräsentation der Kernkonflikte des Romans. Das weite und gleichgültige Meer symbolisiert sowohl die Flucht als auch die Auslöschung und spiegelt den Kampf der Überlebenden mit der Erinnerung wider. Es ist ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen, an dem die Vergangenheit trotz ihrer Bemühungen nicht begraben werden kann.
Auch das Wetter spielt eine entscheidende Rolle für die Stimmung des Romans. Der heraufziehende Sturm ist eine Metapher für die Enthüllung von Geheimnissen – was als langsamer Aufbau von Spannung beginnt, steigert sich zu einer unausweichlichen Abrechnung. Der Strand, ein scheinbar friedlicher Ort, wird durch Mirandas sorgfältige Manipulation der Atmosphäre zu einem bedrohlichen Ort, der verdeutlicht, wie ein Trauma selbst die idyllischsten Orte in Orte des Grauens verwandeln kann.
Letztlich ist Mirandas Roman eine tiefgründige Erforschung der menschlichen Psyche unter Zwang, ein literarischer Thriller, der versteht, dass die schrecklichsten Geheimnisse nicht die sind, die wir vor anderen verbergen, sondern die, die wir vor uns selbst verbergen.