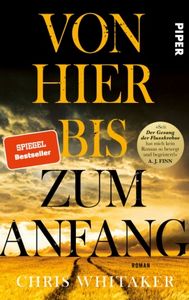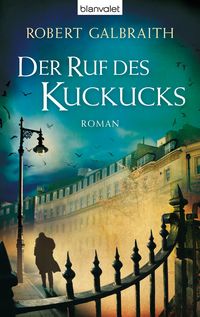Stephen King ist nicht der erste Schriftsteller, der ein Buch Namens „The Outsider“ geschrieben hat. Bevor wir das akzeptieren, müssen wir uns leider wieder einmal über die schlechte Übersetzungsqualität des Heyne-Verlags unterhalten. Es wäre einfach gewesen, den Titel im Original zu belassen, stattdessen zeigt man, dass man mit Sprache nun wirklich nicht mehr umgehen kann. Da wird dann aus „The Outsider“ „Der Outsider“, und jedem Leser, der noch ein bisschen was von Grammatik hält, dreht sich der Magen um. Die Idealform wäre „Der Außenseiter“ oder sogar „Der Fremde“ gewesen. Nun, nicht nur ideal, sondern RICHTIG. Auf die vielen Übersetzungsfehler im Roman gehe ich jetzt gar nicht ein.
Schlagwort: Krimi
Stephen King: Später

„Später“ ist mittlerweile der dritte Roman, den Stephen King für den Spezial-Verlag Hard Case Crime geschrieben hat. Dieser Verlag lässt den Stil der Pulp-Taschenbücher der 40er und 50er Jahre erneut aufleben und ist im Grunde spezialisiert auf Hardboiled-Krimis, die zu dieser Zeit hoch im Kurs standen, hat sich also zur Aufgabe gemacht, die Lebendigkeit, die Spannung und den Nervenkitzel des goldenen Zeitalters der Taschenbücher wiederzubeleben.
Es versteht sich von selbst, dass die dort erscheinenden Bücher ein phantastisches Coverartwork haben, bei uns ist davon natürlich nichts zu sehen.
Tatsächlich handelt es sich um einen Kriminalroman, aber mit übernatürlichem Einschlag.
Fantômas (Genie des Bösen)
Wenn es um Bösewichte geht, ist Fantômas selbst in diesem Kreis noch der Böse. Er wurde 1911 ins Leben gerufen und ist das, was man einen Gentleman-Ganoven nennen könnte, der grausame, sorgfältig geplante Verbrechen begeht, ohne ein klares Motiv zu haben. Manchmal hängt er sein Opfer an eine Kirchenglocke, damit beim Läuten das Blut auf die Gläubigen spritzt. Er versucht, den Detektiv Jove, der ihm auf der Spur ist, zu töten, indem er ihn in einem Raum gefangen hält, der sich langsam mit Sand füllt. Er häutet ein Opfer und macht aus den Händen des Toten Handschuhe, um die Fingerabdrücke der Leiche am Tatort zu hinterlassen.
Raymond Chandler: Der große Schlaf
Zum 80-jährigen Jubiläum begann der Diogenes-Verlag 2019 die Raymond Chandlers Klassiker in einer neuen Übersetzung herauszugeben. Nachdem ich mir das Buch einmal angesehen hatte, das von Frank Heibert neu übersetzt wurde, tendiere ich doch eindeutig zu der Übersetzung von Gunar Ortlepp, die 1974 erschien.
Raymond Chandler sagte einmal, er sei der erste gewesen, der auf realistische Weise über Los Angeles geschrieben habe. Um über einen Ort zu schreiben, sagte er, müsse man ihn lieben oder hassen, oder beides, abwechselnd, so wie man eine Frau liebt. Leere und Langeweile waren zwecklos. L. A. hat ihn nie gelangweilt. Er fand es vielleicht banal, aber niemals leer. Er liebte es (als er 1912 ankam) und hasste es (als er 1946 abreiste), bis es schließlich, wie er sagte, für ihn eine müde alte Hure geworden war. Er hat diese Stadt besser als jeder andere verstanden, ihren Rhythmus und ihre Grobheit, ihre Tankstellen, die verschwenderisch mit Licht gefüllt sind, die Häuser in den Schluchten, die in der Schwärze hängen, den Geruch der Luft, das Gefühl der Winde, den Puls des Ortes, weshalb seine Romane zu keiner Zeit veraltet wirken: Er hat die Essenz der Stadt eingefangen, nicht nur ihre zeitliche Oberfläche.
Alan Bradley: Mord im Gurkenbeet (Flavia de Luce #1)
„Die Streußel schmecken süß, jedoch
viel süßer schmeckt der Boden noch.“

Eines muss ich vorweg schicken: Wir haben es hier nicht definitiv mit einem Jugendroman zu tun, obwohl man sich natürlich glücklich schätzen kann, wenn Jugendliche diesen Roman lesen und auch genießen können. Sicher ist Flavia de Luce ein elfjähriges Mädchen, aber – wie wir gleich sehen werden – unterscheidet sie sich in fast jeder Hinsicht von dem, was man von einem 11-jährigen Mädchen erwarten kann. Tatsächlich ist die ganze Reihe vom Goldenen Zeitalter der Krimis durchtränkt, beeinflusst von der Wertschätzung des Autors für die Arbeit von Chesterton, Agatha Christie, Conan Doyle oder Dorothy L. Sayers. Das heißt, dass es sich um herrlich altmodische Krimis handelt, die mit einigen intellektuellen Seitenhieben aufwarten.
Von Hier bis zum Anfang / Chris Whitaker
Mit seinem dritten Roman „We begin at the End“ hat Chris Whitaker die weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Autor lebt in Großbritannien, siedelt seine Romane aber mit präziser Genauigkeit in den ländlichen Vereinigten Staaten an. Oft genug ist es ja gerade andersherum. Er gewann in diesem Jahr nicht nur den Gold Dagger der Crime Writers Association, sondern wurde von vielen Fachmagazinen als bester Thriller des Jahres ausgezeichnet. Und heute schließe ich mich dem an. Erschienen ist das Buch bei Piper.
Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Buchbesprechung. Kurz vor Schluss des Jahres kann ich jetzt also die Katze aus dem Sack lassen und behaupten, dass es für mich das Buch des Jahres ist.
Fairy Tale / Stephen King
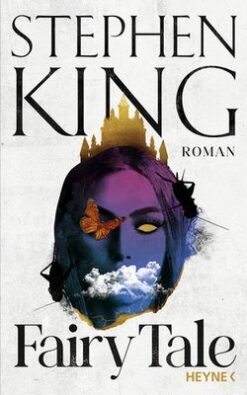
Wenn ein Roman in jüngster Zeit sich gut in das hier besprochene Stephen-King-Multiversum einfügt, dann ist es dieser, den man am ehesten im King-Kanon in eine Reihe mit „Die Augen des Drachen“, die Romane um den dunklen Turm, dem Talisman oder „The Wind through the Keyhole“ (bei uns „Wind“) stellen kann.
Die alternative Märchenwelt des Buches kombiniert Grimmsche Märchenelemente mit Lovecraftschem kosmischem Horror, aber es dauert eine Weile, bis man dort ankommt. Charlie Reade, der Protagonist des Buches, beginnt seine Reise durch den Weltbrunnen erst nach etwa einem Viertel des Buches. Zunächst aber baut King das sorgfältige Porträt von Charlies Leben in der kleinen Stadt Sentry in Illinois auf. Dann aber fließt alles von Rumpelstilzchen bis zu den drei kleinen Schweinchen über Star Wars und den Hunger Games in diese mitreißende Coming-of-Age-Geschichte, die eine Erzählung von menschenfressenden Riesen, elektrischen Zombies, Duellen auf Leben und Tod, einem grausamen Herrscher und einer schönen Prinzessin umspannt.
Billy Summers / Stephen King
In einer begeisterten Rezension schrieb John Dugdale von der Sunday Times: „Diszipliniert, aber abenteuerlich, gleichermaßen gut in Actionszenen und tiefgründiger Psychologie, zeigt King mit diesem Roman, dass er mit 73 Jahren ein Schriftsteller ist, der wieder auf der Höhe seines Könnens agiert.“
Neil McRobert vom Guardian nannte es Kings „bestes Buch seit Jahren“ und lobte seine „eigene Art eines kräftigen, übersteigerten Realismus“.
Seit fünf Jahrzehnten dominiert Stephen King das literarische Erzählen und mit Billy Summers wandert dieser einzigartige Autor weiter auf jenem Pfad, der schon länger vorhanden ist, den er aber mit „Mr. Mercedes“ eindeutig eingeschlagen hat.
Stephen King kennt das Verbrechen. Er ist mit Pulp-Legenden wie Richard Stark und John D. MacDonald aufgewachsen. Um die Wahrheit zu sagen: er war schon immer ein wirklicher Noir-Fan.
Als MacDonald sich bereit erklärte, das Vorwort für Kings Erzählband „Nachtschicht“ zu schreiben, hätte er sich vor Freude fast in die Hose gemacht. Wenn King über seine frühen Inspirationen spricht, fallen unweigerlich die Namen zahlreicher Hardboiled-Autoren. Seine Bücher sind voll mit Verweisen auf seine schriftstellerischen Helden. Ohne Kriminalromane gibt es keinen Stephen King.
Sie haben seine Wut auf das System und seine Haltung gegenüber bestimmten politischen Zuständen inspiriert. Man muss sich fragen, wie Kings Herangehensweise an das Schreiben aussehen würde, wenn er nicht mit dem Verschlingen von Groschenromanen aufgewachsen wäre. Zumindest besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sein Schaffen nicht so überschwänglich gewesen wäre. Das Leben eines Autors von Groschenromanen bestand darin, zu tippen, bis die Finger bluteten, und manchmal ganze Romane in weniger als einem Monat fertigzustellen. Sie schrieben Geschichten über schreckliche Menschen, die schreckliche Dinge taten, und die Leser können bis heute nicht genug davon bekommen. In Kings Romanen ist niemand perfekt. Jeder hat seine Macken. Die Protagonisten begehen oft Verbrechen, nehmen das Gesetz selbst in die Hand und tun alles, was nötig ist, um etwas zu erreichen.
Es stimmt zwar, dass die meisten von Kings Werken übernatürliche Elemente enthalten, aber es lässt sich nicht leugnen, dass viele, wenn nicht alle seiner Bücher, auch als Thriller eingestuft werden können. Nur weil man einen Geist oder ein kinderfressendes unterirdisches Monster hinzufügt, heißt das noch lange nicht, dass man nicht auch einen Thriller vor sich hat. Belletristik ist nicht auf ein bestimmtes Genre beschränkt, und das ist vielleicht der Grund, warum Stephen King eine so erfolgreiche Karriere gemacht hat. Er hat sich von Anfang an nie festlegen lassen und ständig verzweigt, Elemente aus verschiedenen Genres aufgenommen und etwas völlig eigenes daraus gemacht.
Die beiden größten Genres sind sicherlich der Horror, aber auch Krimis. Seine Bücher sind vom Ethos des klassischen Thrillers durchdrungen.
Billy Summers ist ein ziemlich gelungenes und gutes Beispiel für einen echten King mit Thriller-Elementen. Im Wesentlichen ist das Buch erneut und wie so oft eine Charakterstudie. Obwohl dieser Roman viele klassische – für King typische – Marksteine enthält, darunter Rache, einen Schriftsteller-Helden, unwahrscheinliche Freundschaften, Traumata, Gerechtigkeit -, macht hier vor allem seine Hingabe an den Realismus und die intensive, fast meditative Konzentration auf die titelgebende Hauptfigur „Billy Summers“ zu einem herausragenden Werk.
Billy ist ein Auftragskiller. Aber er hat seine Prinzipien. Er tötet nur schlechte Menschen. Einige der Männer, die er getötet hat, waren in der Tat sehr üble Zeitgenossen. Beim Militär hat er sein Talent als Scharfschütze unter Beweis gestellt, und als er entlassen wurde und keine wirkliche Zukunft vor sich sah, beschloss er, die erlernten Tötungsfähigkeiten beruflich zu nutzen. Als wir ihm begegnen, hat er jedoch genug davon. Er ist bereit, sich zur Ruhe zu setzen. Aber vorher nimmt er noch einen letzten Job an.
Die Bezahlung für diesen letzten Auftrag ist astronomisch, und die Zielperson hat ihr Schicksal zweifellos verdient, aber was Billy wirklich überzeugt, den Job anzunehmen, ist die Tarnung, die er annehmen soll: Er muss sich als Schriftsteller ausgeben, der sich in einem Bürogebäude einmietet, um seinen ersten Roman fertigzustellen. Und genau dort wird Billy auch seinen Schuss abgeben.
Sein potenzielles Opfer wird auf den Stufen des Gerichtsgebäudes in der Nähe des gemieteten Büros abgeliefert, in dem Billy seiner Tarngeschichte als Schriftsteller nachgeht.
Billy verbringt Wochen in der Stadt, bevor die Mühlen der Justiz den Mann schließlich in seine Nähe bringen. Während dieser Zeit hält er sich strikt an seine Tarnung, indem er sich tatsächlich im Schreiben versucht. Er beschließt, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben, aber um der Rolle des etwas dümmlichen Typen, die er im Laufe der Jahre perfektioniert hat, treu zu bleiben, nimmt er die Stimme von Benjy Compson an, William Faulkners „idiotischem“ Kind aus „Schall und Wahn“. Dies ist nur eine von mehreren literarischen Anspielungen, die King in diesem Buch macht. Er erwähnt auch Dickens, Wordsworth, Shakespeare, Thomas Hardy und Cormac McCarthy, um nur einige zu nennen. Billy ist sehr belesen, und während des gesamten Buches ist er in die Lektüre von Emile Zolas „Therese Raquin“ vertieft. Überraschenderweise, oder vielleicht auch nicht, stellt er fest, dass ihm das Schreiben Spaß macht und dass er ein Talent dafür hat. In einer Umkehrung von „Shining“, wo ein Schriftsteller zum Mörder wurde, wird hier der Mörder zum Schriftsteller. Tatsächlich bezieht King sich in seinen literarischen Referenzen letztendlich auch auf sich selbst!
King hat im Laufe der Jahre so viele Autoren-Protagonisten geschaffen, dass dies nicht mehr nur ein Running Gag ist, sondern einfach zur Hintergrundstrahlung seines Werks gehört. Aber selten hat er so viel Zeit und Energie in die Darstellung der eigentlichen kathartischen Arbeit des Jobs gesteckt, bis hin zum Verfassen ganzer Kapitel, in denen Billy seine missbrauchte Kindheit und seinen Militärdienst verarbeitet, um das Netz von Identitäten zu entwirren, das er um sich herum aufgebaut hat. Die Begeisterung, mit der Billy erkennt, dass er endlich hinter den Masken hervorschauen und mit seiner eigenen Stimme sprechen kann (wenn auch nur zu sich selbst), hätte in einem anderen Buch kitschig wirken können, aber in Kings Händen wirkt es ansteckend echt. Neben diesen hochtrabenden Ideen sind diese Auszüge auch eine Gelegenheit für King, ein wenig metafiktionale Spielerei zu betreiben und einen Text zu verfassen, der sich wie das Werk eines begabten Anfängers liest und sich von dem vertrauten Ton im Rest des Buches unterscheidet.
Kurz vor dem Abschluss seines Auftrags macht sich Billy Sorgen darüber, dass es einen Plan geben könnte, ihn nach der Tat abzuservieren, und er schmiedet alternative Fluchtpläne. Er verschanzt sich in einer Kellerwohnung in der Stadt und verlässt sie zunächst nicht, wie es sein Auftraggeber vorgesehen hatte. Als er sich eines Nachts in dieser Wohnung aufhält, sieht er, wie drei Männer in einem Lieferwagen ein schlimm zugerichtetes Mädchen auf der Straße abladen. Er geht hinaus, um nach ihr zu sehen, findet sie gerade noch so lebendig und bringt sie ins Haus. Sie wurde von den drei Männern unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Hier beginnt der zweite Teil des Romans, den nachzuzeichnen diese Besprechung hier sprengen würde.
Ich möchte zum Ende nur darauf hinweisen, dass es das Schreiben ist, das Billy Summers rettet – sowohl die Prosa selbst als auch die Darstellung der Handlung. Zusammen geben sie dem Buch die Rettungsleine, die es braucht, wenn sich das aus den Schlagzeilen gerissene Ende abzeichnet. Selbst in den abgedroschensten Verbrechensszenarien schafft es King, aus der kleinsten Abweichung vom Plan eine Flutwelle der Spannung aufzubauen, die seine „Dauerleser“ tief in die schweißnasse Unsicherheit seiner Helden eintauchen lässt, während sie beobachten, wie eine Situation möglicherweise außer Kontrolle gerät. Indem er Billys Sühne in Kommunikation und Schöpfung und nicht in Gewalt verortet, gelingt es King, einen Raum für Erlösung zu finden, der andernfalls vielleicht hohl geklungen hätte. Für ein Buch, dessen einziges übernatürliches Element die gelegentlich auftauchende Ruine des weit entfernten Overlook Hotels ist – wo ein anderer King-Schriftsteller-Stellvertreter einst weitaus schlechter mit seiner Isolation und seinen „Gaben“ zurechtkam -, ist Billy Summers auf gewinnende Weise optimistisch gegenüber des kreativen Geistes. Mehr als fast jedes andere King-Buch der jüngeren Vergangenheit ist es ein Produkt seiner Zeit.
Der Seidenspinner / Robert Galbraith
Es ist fast unumgänglich, dass nahezu jede Besprechung von Rowlings großartiger Krimireihe, die 2013 mit Der Ruf des Kuckucks ihren mehr als soliden Start markierte, mit Hinweisen auf Harry Potter gespickt ist. Es ist fast zu schade, dass ihr Pseudonym Robert Galbraith so früh schon gelüftet wurde, die Rezensionen sähen anders aus. Und wie man sieht, komme auch ich nicht umhin, ihre berühmten Kinder- und Jugendbücher zu erwähnen.
Dass Rowling eine herausragende Autorin ist, kann nur ein Dummkopf bestreiten. Dass sie einen soliden Krimi schreiben kann, war deshalb keine große Überraschung.
Im ersten Roman folgten wir Cormoran und seiner neuen Sekretärin Robin Ellacott, wie sie den mysteriösen Tod des Models Lula Landry aufklärten. Strike litt noch unter der Trennung von seiner verlobten Charlotte und sein Detektivgeschäft ging gerade den Bach runter. Im „Seidenspinner“ geht es aufwärts: Das Geschäft boomt, es gibt jede Menge Kunden, und Cormoran kann es sich sogar leisten, nicht mehr in seinem Büro wohnen zu müssen.
In „Der Seidenspinner“ begibt sich die Autorin auf ein Terrain, das dunkler und verstörender ist als dieser – bereits gelungene – Auftakt. Rowling hat nicht lange gebraucht, um sich in diesem Genre nicht nur umzusehen, sondern auch gleich ein Spitzenwerk abzuliefern, das viele ihrer langjährigen Kollegen auf die Plätze verweist.
Strike wird hier von der Frau des verschwundenen Autors Owen Quine (Kwein) engagiert, um ihn zu finden und er nimmt an, obwohl er weiß, dass es sich womöglich nicht auszahlen wird.
Quine verschwand, als er die Nachricht erhielt, dass sein neuestes Manuskript nicht veröffentlicht werden kann, weil er dort verschiedene Berühmtheiten aus der Welt der Literatur in bösartiger Weise porträtierte. Was folgt, ist ein sadistischer Mordfall, und damit sind Cormoran und Robin gezwungen, sich ihren Weg durch den trüben Sumpf der Verlagsbranche zu bahnen, während im ersten Band die Paparazzi ihr Fett weg bekamen. Rowlings Lebenserfahrung ist also nicht zu übersehen. Sowohl „Der Ruf des Kuckucks“ als auch „Der Seidenspinner“ dekonstruieren die Vorstellungen von Erfolg, Ruhm und einem Leben im Rampenlicht.
Als Cormoran im Zeitschriftenregal nach einer Ausgabe des Tatler sucht, in dem seine Ex-Verlobte abgebildet ist, entdeckt er Emma Watson auf dem Titelblatt der Vogue – ein echter Agatha-Christie-Witz.
Im ersten Band wurde sehr eindringlich beschrieben, wie er in einer Limousine sitzt und von Paparazzi verfolgt wird. Diesmal gibt es einige besondere Seitenhiebe auf die zweifelhaften Literaturwelt.
Ein Autor erklärt Strike: „Wer lebenslange Freundschaft und selbstlose Kameraderie sucht, sollte zur Armee gehen und das Töten lernen. Wer sich ein Leben voller temporärer Allianzen mit Kollegen wünscht, die sich im Versagen des anderen sonnen, muss Romane schreiben“. Es ist unmöglich, hier nicht Rowlings ganz persönliche Erfahrung herauszulesen. Und es ist leicht zu verstehen, warum sie sich dafür entschied, unter einem Pseudonym zu veröffentlichen: Sie wollte wegen ihrer schriftstellerischen Arbeit und nicht wegen ihrer Berühmtheit wahrgenommen werden. Während die hochnäsigeren Schichten der literarischen Welt sie vielleicht belächeln, weil sie im Grunde nicht so viel von Literatur verstehen wie sie vorgeben, zeigt sie dem echten Verständigen einmal mehr, welch überragende Gabe zur Beschreibung sie hat.
Rowling hat es sich bei der Entwicklung ihres Privatdetektivs nicht einfach gemacht, weil es diese Art vom Ermittler heute nicht mehr gibt. Ein Privatdetektiv hat kaum die Möglichkeit, in einem Mordfall zu ermitteln und man muss sich schon etwas einfallen lassen, um ein glaubhaftes Szenario zu entwerfen, bei dem das gelingen kann. Nicht, dass mich das in irgendeiner Weise interessieren würde, aber Rowling gelingt es, Strikes Fälle legitim darzustellen. Dabei hat sie mit Cormoran Strike auch noch einen höchst interessanten Detektiv entworfen. Er ist als uneheliches Kind eines alternden Rockstars sogar selbst eine kleine Berühmtheit und schafft es unter all den zahlreichen Ermittlern, die es mittlerweile gibt, zu den besten ihrer Zunft aufzusteigen.
Die Beziehung zwischen Cormoran und Robin entwickelt sich hier auf interessante Weise, und einer der Haupthandlungsstränge hier betrifft die Ausweitung ihrer bisherigen Rolle. Robins Beziehung zu ihrem langjährigen Verlobten Matthew steht weiterhin unter seinem rigorosen Unmut, dass seine baldige Frau, die als Sekretärin anderswo bei weitem mehr Geld verdienen könnte, für einen – für ihn – windigen Detektiv arbeiten will.
Strike weist in einer seiner Überlegungen den Leser darauf hin, dass die Bedingung dafür, dass Robin mit ihrem Verlobten zusammenbleibt, darin besteht, dass sie „nicht sie selbst ist“, und es gibt eine allgemeinere Betrachtung über die Schwierigkeiten, sich von einer langjährigen Liebe zu trennen.
Es gibt eine ganze Reihe dysfunktionaler Paare in „Der Seidenspinner“, von den trunksüchtigen Waldegraves über die kaltblütige Arroganz der Fancourts, der repressiven Chards bis hin zu den überaus seltsamen Quines. Leonora Quine ist eine wunderbar gezeichnete Figur: verkorkst und mürrisch, nur mit ihrer Tochter beschäftigt und ziemlich desinteressiert an ihrem Mann. Sie las seine Bücher nur, sobald sie einen ordentlichen Einband hatten, und sie weigert sich hartnäckig, von der Entwicklung der Ereignisse schockiert zu sein. In beiden Teilen von Cormoran Strikes Abenteuern ging es mehr um die Beziehungen zwischen den Figuren als um das Endziel, und in der Tat scheint der wahrhaftigste Bösewicht von allen Cormorans ehemalige Verlobte Charlotte zu sein, die so etwas wie die Irene Adler für Holmes ist. Dabei wird sie zwar andauernd erwähnt, ist aber noch nicht wirklich in Erscheinung getreten.
Wie geschickt Rowling darin ist, die Entwicklung ihrer Figuren zusammen mit einem interessanten Fall zu präsentieren, und nicht nur nebeneinander, zeigt sie hier mit einer Grandezza, die eigentlich alle Kritiker zum Verstummen bringen müsste. Wie wir wissen, ist das natürlich nicht der Fall. Mindere Geister werden ihr ihren Erfolg weiterhin neiden.
Colin Dexter: Der letzte Bus nach Woodstock (Inspector Morse #1)
Der 2017 verstorbene Norman Colin Dexter formte einen der beliebtesten und berühmtesten Detektive sehr nach seinem eigenen Vorbild. Auch Dexter war ein Liebhaber englischer Kreuzworträtsel (nicht zu verwechseln mit den unsrigen) mit einem blitzschnellen Verstand, ein von Diabetes geplagter Biertrinker und ein Kenner klassischer Musik. Bis zum Schluss kannten die Leser weder den Vornamen des Autors noch den von Morse. Erst später stellte letzterer sich als Endeavour heraus.
Um sich eine Pause von seinen launischen Kindern zu gönnen, begann Dexter 1972, die ersten Absätze eines Kriminalromans zu notieren. Zunächst war es sein einziges Ziel, sich etwas Zerstreuung zu gönnen. Daraus wurden 13 Romane und die beliebteste britische Fernsehserie aller Zeiten mit John Thaw als Inspektor Morse, die bald ein Prequel und ein Sequel bekam. Der letzte Roman der Morse-Reihe wurde 1999 veröffentlicht und beschließt einen Zeitraum von 25 Jahren. Auf der Liste der besten Detektive aller Zeiten rangiert er auf Platz 7, hinter Sam Spade, aber vor Father Brown.
Robert Galbraith: Der Ruf des Kuckucks (Cormoran Strike #1)
Als „Der Ruf des Kuckucks“ im April 2013 erschien, wurden nur 1500 Exemplare verkauft, was für einen völlig unbekannten Autor dennoch gar kein so schlechtes Ergebnis ist. Als die Sunday Times im Juli des Jahres jedoch verlauten ließ, dass es Hinweise darauf gebe, dass hinter dem neuen Namen Robert Galbraith J. K. Rowling ihr Krimidebüt gegeben hatte, geriet die Welt in einen Kaufrausch und das Buch kletterte ohne Umschweife auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste.
Natürlich werden da viele Leser, die mit Harry Potter aufgewachsen sind, allein schon aus einer Gewissen Hoffnung auf einen Nostalgie-Effekt zugegriffen haben, auch wenn sie – wie sie schnell bemerkt haben dürften – mit der Krimi-Rowling dann doch nicht besonders warm geworden sind. Das ist keine pure Behauptung; man lese sich nur zum Vergnügen gerne einige negativ bewertete Aussagen zum Buch durch. Da trifft man reihenweise auf enttäuschte Potterheads.
Der Opiummörder / David Morrell
David Morrell hat in seinen drei De Quincey-Romanen den historischen Kriminalroman unendlich bereichert. Nicht nur, dass sie zum besten zählen, was es auf dem Sektor des viktorianischen London zu lesen gibt, es ist auch eine Meisterleistung der Recherche. Vater und Tochter De Quincey werden im Grunde nur von Sherlock Holmes selbst übertroffen, mit dem einen Unterschied, dass es De Quincey wirklich gab.

Kermit der Frosch (Es ist nicht einfach, grün zu sein)
Kermit der Frosch ist ein internationaler Star von höchster Bedeutung und die berühmteste Amphibie der Welt, begann aber ganz bescheiden.

Stephen King Re-Read: The Stand
Das letzte Gefecht (The Stand) war ein Meilenstein für Stephen King, und das nicht nur, weil die Größe und das Gewicht des Buches einem tatsächlichen Meilenstein in nichts nachsteht. Es war das letzte Buch für den Verlag Doubleday und brachte ihm seinen ersten Agenten ein, der Stephen King von einem reichen Autor zu einem sehr, sehr reichen Autor machte. In schreibspezifischer Hinsicht gibt es jedoch einen anderen Punkt, der das letzte Gefecht über alles stellt, was der Autor bis dahin geschrieben hatte: es ist lang. Sehr lang. Und das ist wichtiger als man zunächst annehmen mag.
Nachdem King seinen Roman Shining beendet hatte, dauerte es einen Monat, bis er mit seinem nächsten Buch begann: The House on Value Street. Darin sollte es um die Entführung der Verleger-Tochter Patty Hearst gehen. King war der Meinung, dass diese Entführung nur für einen Romancier Sinn ergeben könnte. Doch nach sechs Wochen Arbeit schaffte er nur ein paar Zeilen. Was aber noch schlimmer ins Gewicht fiel für einen charakterbasierten Schriftsteller wie King: seine Figuren fühlten sich leblos an und aus anderen Büchern entlehnt. So saß er vor seiner toten Schreibmaschine, umgeben von Recherchematerial und dachte an den Dugway-Vorfall von 1968. In diesem Dugway-Areal kam es zu einem Unfall: die Army hatte bei einem Nervengas-Test zufällig 3000 Schafe getötet. Er dachte auch über George R. Stewards Buch Leben ohne Ende nach, in dem eine Pandemie fast die ganze Menschheit auslöscht. Außerdem erinnerte er sich an etwas, das er vor kurzem bei einem christlichen Radiosender gehört hatte: “Einmal in jeder Generation wird die Plage über sie kommen.”
Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle / Stuart Turton
Stuart Turtons Debütroman „Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle“ ist ein origineller, hochkomplexer Kriminalroman, der als eine Mischung aus Robert Altmans Gosford Park und Christopher Nolans Inception beschrieben wird, allerdings in Anlehnung an Agatha Christies „Mord im Orient Express“, denn obwohl es sich hier um die Aufklärung eines Mordes handelt, ist der übergeordnete Hintergrund eher in der Phantastik zu suchen.
Als der Roman 2018 erschien, konnte es für viele Kritiker keinen Zweifel geben, dass dieser höchst originelle Krimi das beste Buch des Jahres sein würde, und so bekam Stuart Turton auch gleich den Costa Book Award für das beste Debüt.
Stuart Turtons Erstling „Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle“ ist ein Buch voller Überraschungen. Der Roman folgt dem Protagonisten Aiden Bishop, der versucht, den Mord an eben jener Evelyn Hardcastle aufzuklären – und im Idealfall sogar zu verhindern. Jeden Morgen wacht Bishop in einem neuen Körper auf und muss denselben Tag acht Mal wiederholen. Außerdem muss er den Mord an Evelyn vor Ablauf der acht Tage aufklären, um nicht zu riskieren, dass er die gesamte Erfahrung vergisst und alles noch einmal von vorne beginnt. Wie Aiden dorthin gekommen ist, weiß er nicht.
Das heruntergekommene Anwesen, auf dem das geschieht, gehört den Hardcastles, die Freunde und Bekannte zu einer Party versammelt haben, bei der um 23 Uhr ihre Tochter Evelyn ermordet wird, und dieser Tag wiederholt sich in einer Schleife. Aiden kann diesen Ort nur dann verlassen, wenn er das Rätsel des Mordes löst.
Wenn Aiden in seine acht verschiedenen Körper schlüpft, ist er gezwungen, mit acht verschiedenen Persönlichkeiten und Instinkten zu interagieren. Aidens erster Wirt ist zum Beispiel Sebastian Bell, ein Arzt. Bell ist ein kleiner Mann, der neugierig, ängstlich und intelligent ist. Als Aiden zum ersten Mal in Bell erwacht, findet er sich verwirrt im Wald des Anwesens wieder. Er kann sich nur an einen Namen erinnern: Anna. Erst bei seinem zweiten Wirt merkt Aiden, dass er zwischen den Körpern hin und her springt. Mit seinen zusätzlichen Tagen und seiner zusätzlichen Zeit ist er entschlossen, Evelyns Mord nicht nur aufzuklären, sondern ihn gar nicht erst geschehen zu lassen. Doch dazu müsste es ihm gelingen, den Ablauf zu verändern.
Selbst der einzige scheinbar immer gleiche Teil des Romans, das Anwesen selbst, verändert sich langsam mit der fortschreitenden Ermittlung. Turton konzentriert sich in die verwilderte europäische Landgut-Ästhetik, die er im Buch anlegt. Der Leser stößt ständig auf Fragmente des großen Hauses und des weitläufigen Geländes. Trotz des isolierten Schauplatzes bekommen wir durch die Perspektivwechsel jeden neuen Körpers, den Aiden ins Abenteuer schickt, andere Details und Erkenntnisse präsentiert.
Allerdings hat der ständige Wechsel der Perspektive auch seinen Preis. Natürlich zeichnet sich der Roman durch seine ungewöhnliche und kreative Prämisse aus, ist aber nicht in der Lage, die Handlung auszufüllen und die Figuren zu einem befriedigenden Ende zu führen. So muss der Leser eine Wendung nach der anderen hinnehmen – die meisten davon sind nicht vorhersehbar und entbehren in der Regel jeglicher Logik, auch wenn sie höchst unterhaltsam sind.
Aufgrund des ständigen Wechsels zwischen den Charakteren fühlen sich selbst die am stärksten ausgeprägten Personen ein wenig stagnativ an. Der größte Teil der Charakterentwicklung findet parallel zu den eben erwähnten Wendungen statt, so dass die Charaktere oft eine große äußere Entwicklung, aber eine erzwungene innere Entwicklung erfahren. Selten wird den Figuren eine Hintergrundgeschichte gegeben, wenn aber doch, dann meist in Form eines plötzlichen Ereignisses, an dem die Figur fast augenblicklich reift und wächst, was eine effiziente, aber letztlich künstliche und unbefriedigende Art ist, Turtons Figuren kennenzulernen.
Der Roman neigt auch dazu, mehr Fragen aufzuwerfen als zu beantworten. Es gibt einen Unterton im Werk, einen ständigen Strom von Fragen, die den Leser wahrscheinlich verwirren und sein Interesse aufrechterhalten sollen. Dies kann zwar ein wirksames Mittel innerhalb des Genres des Kriminalromans sein, doch wird der Leser nie richtig in die Lage versetzt, diese Fragen selbst zu lösen, was zu Enttäuschung und Unzufriedenheit führt, die nicht mit der durch die Handlung beabsichtigten Gesamtspannung in Einklang stehen. Trotz dieser Kritikpunkte ist Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle eine äußerst kreative und unterhaltsame Lektüre. Auch wenn das Buch selbst in seinem Genre nicht bahnbrechend ist, gelingt es ihm doch, den klassischen Krimi-Tropen einen einzigartigen Dreh zu geben. Es ist ein Whodunit, der auf höchst faszinierende Weise erzählt wird.