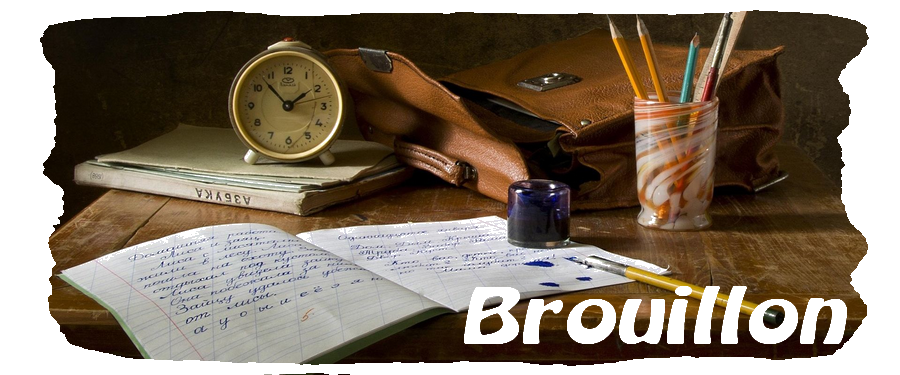Jedes Buch verändert sich beim Lesen; liest man es erneut, steht etwas völlig anderes darin. Auch wenn man in erwartender Vorfreude denkt: Gleich kommt die Szene, in der…, selbst dann wird es nicht die gleiche Szene sein, sondern nur die Konzeption der Szene ist ein Wiedererkennen wert. Zumindest verhält es sich so bei guten Büchern (was keine Klasse beschreibt und akademisch gearteten Dreck garantiert nicht meint). Arno Schmidt klagte seiner Zeit bereits über künstlerischen Abfall; welche Worte müsste er heute finden, da die letzten klugen Menschen andere Welten durchstreifen. Der 2016 verstorbene Umberto Eco, dann der von John Ashbery 2017 und Friederike Mayröcker 2021 hat unserern Feuerball führungslos gemacht und tatsächlich liegt alles Wesentliche in Ruinen. Ist es nicht die fürchterlichste aller denkbaren Welten, in der ausschließlich Idioten fleuchen?
Brouillon
der BROUILLON ist tagesgeschäft, nicht mehr als journaling über unwichtige persönliche befindlichkeiten.
Wünschenswerte Apokalypse
Ich verhalte mich so, als gäbe es keine Menschen mehr – was von einer Tatsache nicht weit entfernt ist. Ich frage mich dann: würde ich schreiben und sprechen, wenn diese – für mich im Grunde wünschenswerte – Tatsache einmal eintreten sollte. und die Antwort ist: natürlich. Ja, das würde ich, denn ich tue es ja jetzt auch; und der Unterschied ist nur marginal.
Schmierige Tage
Es sind schmierige Tage, diese Tage – und die Nächte sind ein Dilemma für sich, die mich auch am Tag nicht loslassen. Wie sollten sie auch, wüssten sie doch mit ihren Klauen sonst nichts anzufangen. Das Unbekannte geht mir ungeheuer auf die Nerven. Wie kann man eine Fleischmaschine nur derart verhöhnen, ihr immer nur das Gefühl geben, sie hätte für sich selbst etwas entdeckt, für sich selbst etwas evaluiert, die schiefen Sandmäuerchen am Strand durch eigenes Denkmanöver vor das Meer gepflanzt, das nun gar nicht zu bemerken scheint, dass der Gegner an Land mit seiner Plastikschaufel unüberwindbar ist. Die Welt erinnert mich durchaus an eine Weißwurstpelle, die im Aschenbecher des Hofbräuhauses liegt. Ich habe die Geschichte schon erzählt, wie einst dort Beutelschneiderinnen, die sich als Klofrauen ausgaben, das Schwanzkommando, das gegen die Wände pisste, dirigierte. Nur waren das keine schmierigen Tage, sondern lebendige Höfe in einem Taschenuniversum. Zumindest von hier aus gesehen.
Neu bezahnt
Ich bin neu bezahnt, nachdem meine Lücken absonderliche Zischlaute hervorbrachten, die es mir unmöglich machten, einen vernünftigen Satz zu vertonen, wobei gerade das Vertonen mir jetzt gar nicht mehr wichtig erscheint, schließlich habe ich genug Beispiele, Nebenspiele, Hauptspiele und Unsinnigkeiten vertont. Zu schweigen von den Podcasts, die noch nicht alle in der Veranda angekommen sind. Das hat Zeit, scheint unwichtig, gerade weil die Veranda im stillen vor sich hin wächst, selbst ein absonderliches Konstrukt ist – ziellos und im Grunde nur dazu da, Tinte zu sparen, die gar nicht gespart werden müsste (denn ich schmiere ohnehin erst in ein Heft, bevor ich taste). Es ist sehr viel Wandel im Gange und paradoxerweise scheint mir nichts wichtiger als ein Gedicht. Als ich mit dem Lorebuch 2018 begann, war es ein Gedicht, das jetzt zu einem Langgedicht wird. Andererseits widerspricht das meinen Momentaufnahmen, der Vorstellung (alles ist Vorstellung), dass ich niemals den gleichen Ton treffe, nachdem ich den Stift beiseite gelegt habe. Das bedeutet: selbst wenn ich fünf Gedichte an einem Tag schreibe (was vorkam, wenn auch selten), sind sie nicht unbedingt in der gleichen Fason, wenn auch doch im gleichen Stil. Das hat mit Zähnen sehr wenig zu tun, spielt sich aber in der gleichen Luft ab, im gleichen Luftraum, insofern man seine Träume nicht auslüftet.
Das eigentliche Unikat
Es gibt einen neuen Klang, einen Ton nach dem Lorebuch, die unter dem LIVEBOOK entstehen. In der Lorebuch-Endphase dachte ich noch, dass dieser 2018 begonnene Abschnitt weitergeführt werden müsste (und könnte), aber eines der merkwürdigsten Instrumentierungen (insofern ich mich als „bestückt“ bewerte), hat mit den unsichtbaren Grenzen zu tun, die eine Stimmung von der anderen trennt. Nie könnte ich zB wieder an den Stratumgedichten arbeiten, GrammaTau und Huntertprosa fielen etwas leichter, würden aber den Punkt nicht mehr treffen. Diese unidentifizierbaren Ströme sind es, die mich durch ein Dichterleben navigieren, das ich nun nicht umhinkomme, als solches endgültig zu akzeptieren. Meine vehemente Abwehr gegen jegliche Art des Schreibens war nicht ertragreich. Keine Gegenwehr hat sich als erfolgreich herausgestellt. Ich hasse das Schreiben nicht mehr, hasse nicht mehr die Destination, zu der es nicht führt. Ich bin kein Dichter wie irgendein anderer lebender Dichter. Ich bin das eigentliche Unikat in einer deformierten Welt.
Das Privatgespräch
Es ist stets die Frage, warum man die Faulheit und Bequemlichkeit der Leser berücksichtigen sollte, warum man sich einer zeitgeistigen Sprache bedienen sollte, die diesen geistigen Rost miteinbezieht, warum man alle Kunst, die Sprache betreffend, zu Grabe tragen sollte. Diese Frage stelle ich allerdings nur mir selbst, der ich zwischen der obligaten Lesbarkeit und der Gewissheit, gewisse Wahrnehmungen nicht ohne irritatives Moment darstellen zu können, schwanke. Es geht – wie immer – um Konventionen. Was ist eine private Sprache wert, die ungebräuchlichen Elementen den Vorzug gibt? Ist das Zwiegespräch mit sich selbst am Ende gar der einzig gangbare Weg?
Früher schwebte mir ein Museum vor, bestehend aus Klangskulpturen und Texten, Reflexen und Selbstbeobachtung. Aber was ich da beobachtet hatte …. das war der Beobachter selbst, da gab es kein Objekt mehr. Nun, das gibt es nie. Nur wenn man kein Beobachter mehr ist, sondern ein flüchtig Sehender.
Eine neue Prosa widersetzt sich vor allem dem leicht Verständlichen. Wir sprechen nicht die gleiche Sprache, die Dichter und das Volk. Während in der „Gesellschaft“ keiner weiß, was Sprache ist, gefällt sich der Dichter in seinem Instrumentendasein, weiß ebenfalls nicht, was Sprache ist, ist allerdings der Quell des Universums, an dessen tatsächlichen Rätseln beteiligt. Der Dichter lebt nicht mit. Ich lebte nie mit, ein Außenseiter durch und durch (to the bones), nie gab es eine Gestalt wie mich in meinem Umfeld, nie war eine Verständigung in ihren Grundsätzen möglich. Der Beobachter nach innen. Eine kurze Zeit der Wahrnehmung war mir gewährt, in der ich nach draußen drang, aber auch da war ich ein Quell, dem man brachte.
Schieße hier hin, Hexe, und zerstäube meine Rachegelüste
Ich bin nun seit zwei Wochen in einer Wirrnis aus Analgetika gefangen, die den Schmerz eines eigentlich simpel klingenden Hexenschusses nicht etwa aufhebt, aber dafür die Sinne auf chemische Weise zerstäubt. Lumbago ist ein fieses Ding.
Von der Lebensgefahr beim Schreiben
Wer schreibt, liest. Das eine bedingt das andere: eine Binsenweisheit. Nur ist es nicht immer so, dass man das schreibt, was man liest. Der Leseprozess selbst ist ein Schreibprozess, zumindest dann, wenn man lesen kann. Was sich wie Provokation anhört, ist gar nicht so unerhört, denn beim Lesen entsteht ein Gedankenraum im Leser, der vom Autor gar nicht intendiert war, von dem er nie Kenntnis haben wird, denn der Autor wird nie Leser seines Buches sein, sondern immer nur der anderen. Der Autor ist also vom Lesen ausgenommen, auch wenn es sich bei dieser Blockade nur um seine Bücher handelt. Der Schreiber öffnet einen Gedankenraum, den er vom Lesen kennt, und dann taucht er seine Feder ein und zeichnet aufs Papier, was er beim reinen Lesen ohne seine Hand erkennt. Jeder spürt die Gefahr, die beim Schreiben vom ersten Augenblick da ist. Die meisten ignorieren sie, andere lassen sich von dieser Gefahr treiben. Diese Lebensgefahr wird sie zur Meisterschaft bringen.