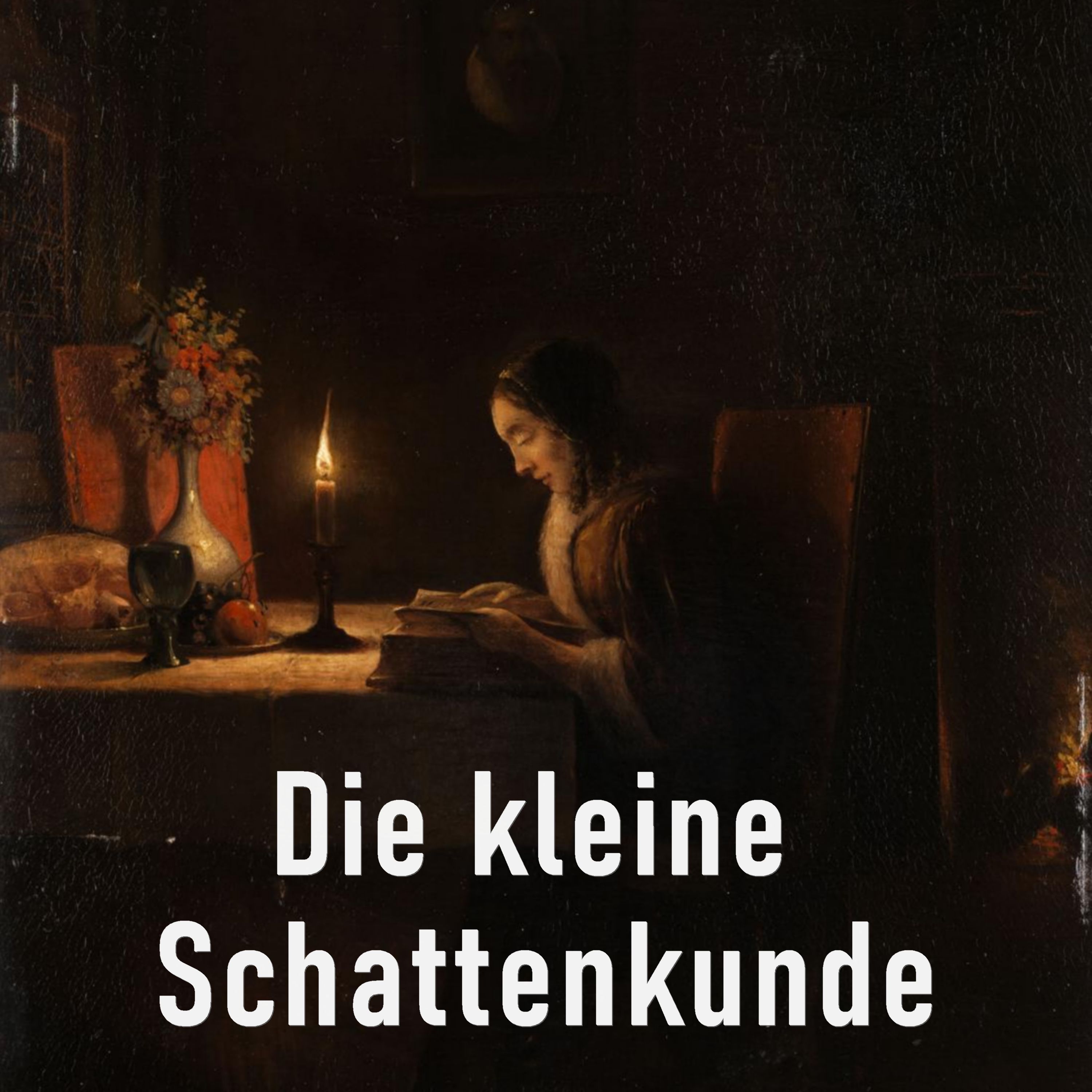Valdimar Jóhannssons Regiedebüt „Lamb“ ist ein atmosphärisches Kammerspiel, das sich – ganz im Stil des modernen Horrorkinos – den Konventionen des Genres entzieht und stattdessen eine beunruhigende Parabel über Verlust, Sehnsucht und die Grenzen menschlicher Kontrolle über die Natur erzählt. Der Film bewegt sich zwischen folkloristischem Horror und psychologischem Drama und schafft dabei eine einzigartige, verstörende Atmosphäre.
Das kinderlose Ehepaar María und Ingvar lebt auf einer abgeschiedenen Schafsfarm in den isländischen Hochlanden. Als eines ihrer Schafe ein außergewöhnliches Lamm zur Welt bringt – halb Mensch, halb Schaf – entscheiden sie sich, das Wesen als ihr eigenes Kind aufzuziehen und nennen es Ada. Während María und Ingvar in ihrer neuen Elternschaft aufblühen, deutet sich durch subtile Zeichen an, dass die Natur ihr Kind zurückfordern wird.
Der Film ist in Kapitel unterteilt und folgt einem langsamen, meditativen Rhythmus. Jóhannsson nimmt sich Zeit für seine Geschichte und setzt auf atmosphärische Dichte statt auf schnelle Wendungen. Die Struktur erinnert an ein Märchen mit düsterer Grundstimmung.
Die Bildsprache von „Lamb“ ist bemerkenswert zurückhaltend und bedrohlich zugleich. Kameramann Eli Arenson nutzt die karge, nebelverhangene isländische Landschaft als eigenständigen Charakter. Die weiten Einstellungen betonen die Isolation der Protagonisten, während die Natur omnipräsent und undurchdringlich erscheint.
Die Farbpalette bewegt sich in Grau-, Grün- und Brauntönen, die die emotionale Kälte und Trostlosigkeit unterstreichen. Das Licht ist meist diffus, was der gesamten Erzählung etwas Unwirkliches verleiht. Jóhannsson vermeidet grelle Schockmomente und setzt stattdessen auf eine schleichende, unbehagliche Spannung.







 m Laufe der Jahrhunderte hat das Erzählen und Nacherzählen der traditionellen Robin-Hood-Geschichten dazu geführt, dass eine schier unendliche Vielzahl von Interpretationen entstanden ist, die sich in Comics, Accessoires, Filmen, TV-Serien, Computerspielen usw. niederschlägt. Da es an unbestrittenen historischen Beweisen mangelt, hat jeder „Geschichten
m Laufe der Jahrhunderte hat das Erzählen und Nacherzählen der traditionellen Robin-Hood-Geschichten dazu geführt, dass eine schier unendliche Vielzahl von Interpretationen entstanden ist, die sich in Comics, Accessoires, Filmen, TV-Serien, Computerspielen usw. niederschlägt. Da es an unbestrittenen historischen Beweisen mangelt, hat jeder „Geschichten