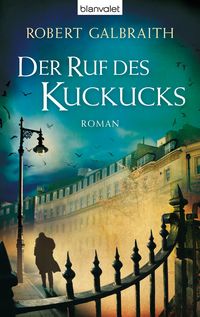Als „Der Ruf des Kuckucks“ im April 2013 erschien, wurden nur 1500 Exemplare verkauft, was für einen völlig unbekannten Autor dennoch gar kein so schlechtes Ergebnis ist. Als die Sunday Times im Juli des Jahres jedoch verlauten ließ, dass es Hinweise darauf gebe, dass hinter dem neuen Namen Robert Galbraith J. K. Rowling ihr Krimidebüt gegeben hatte, geriet die Welt in einen Kaufrausch und das Buch kletterte ohne Umschweife auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste.
Natürlich werden da viele Leser, die mit Harry Potter aufgewachsen sind, allein schon aus einer Gewissen Hoffnung auf einen Nostalgie-Effekt zugegriffen haben, auch wenn sie – wie sie schnell bemerkt haben dürften – mit der Krimi-Rowling dann doch nicht besonders warm geworden sind. Das ist keine pure Behauptung; man lese sich nur zum Vergnügen gerne einige negativ bewertete Aussagen zum Buch durch. Da trifft man reihenweise auf enttäuschte Potterheads.