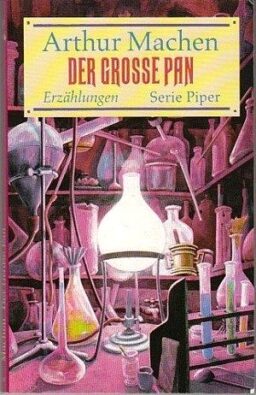Die Geschichte der Vampire ist umstritten. Manche behaupten, sie seien „so alt wie die Welt“. Neuere Forschungen deuten jedoch darauf hin, dass unser Glaube an Vampire und Untote in 18. Jahrhundert entstand, als die ersten europäischen Berichte über dieses Phänomen erschienen.
Wir wissen, dass 1732 das Annus Mirabilis des Vampirs war. In diesem Jahr wurden 12 Bücher und 4 Dissertationen zu diesem Thema veröffentlicht. Laut dem Gothic-Experten Roger Luckhurst taucht der Begriff „Vampir“ in diesem Jahr zum ersten Mal auf. Archäologische Funde ungewöhnlicher Bestattungen in Europa in den letzten Jahren legen jedoch nahe, dass der Glaube an Vampirismus und Wiedergänger die Menschen schon vor 1500 beschäftigte.
So wird auf einem alten Friedhof in Kamien Pomorski in Polen die Leiche eines 500 Jahre alten „Vampirs“ ausgestellt. Die 2015 entdeckte Vampirleiche wurde in der Weltpresse ausführlich beschrieben. Archäologen bestätigten, dass sie einen Pfahl im Bein hatte (vermutlich um zu verhindern, dass sie ihren Sarg verließ) und einen Stein im Mund (um zu verhindern, dass sie Blut saugte). Noch ältere Bestattungen dieser Art wurden in bulgarischen Dörfern gefunden.
Vampire verkörpern seit jeher die menschliche Angst vor dem Tod. Die Spuren, die diese mythische Gestalt in unserer kollektiven Vorstellungswelt hinterlassen hat, lassen sich über Jahrhunderte bis in den Nahen Osten und nach Südasien zurückverfolgen. Im babylonischen Epos Gilgamesch, genauer gesagt auf der sechsten Tafel, die der Göttin Ischtar gewidmet ist, wird ein Wesen beschrieben, das „fähig ist, anderen das Leben zu nehmen, um sein eigenes zu retten“. Es gibt auch alte griechische Bauernlegenden über Männer und Frauen, die Blut trinken, um jung zu bleiben, und über umherirrende Geister, die große Mengen Blut von den Lebenden trinken, um ihre menschliche Gestalt wiederzuerlangen.
Aber all diese Beispiele sind nur Schatten, die sich im Laufe der Jahrhunderte ansammeln mussten, um dem Vampir eine Gestalt und eine Mythologie zu geben. Es ist offensichtlich, dass schon lange vor dem Mittelalter in weiten Teilen Europas an eine Form des Vampirs geglaubt wurde. Doch erst 1819, als der erste fiktive Vampir, der satanische Lord Ruthven, in einer Erzählung von John Polidori auftaucht, hinterlässt der verführerische romantische Vampir seine Visitenkarte in der feinen Londoner Gesellschaft. Wie hat sich unsere Vorstellung vom Vampir vom ungepflegten Bauern zum verführerischen byronischen Aristokraten gewandelt? Um die Geschichte des Vampirs vollständig zu verstehen, müssen wir ihn bis zu seinen Anfängen im frühen Volksglauben zurückverfolgen.
In den ersten schriftlichen Berichten über europäische Vampire werden diese Wesen als Wiedergänger oder Heimkehrer dargestellt, oft in Form eines kranken Familienmitglieds, das in der unglücklichen Gestalt eines Vampirs zurückkehrt. In solchen Erzählungen dominiert eine „unerledigte Aufgabe“, auch wenn diese nicht weniger trivial erscheint als das Fehlen von Kleidung oder Schuhen als Grund für die Rückkehr ins Leben.
Die Anzahl der Begriffe für den „Vampir“ kann ziemlich frustrierend sein: Krvoijac, Vukodlak, Wilkolak, Varcolac, Vurvolak, Liderc Madaly, Liougat, Kullkutha, Moroii, Strigoi, Murony, Streghoi, Vrykolakoi, Upir, Dschuma, Velku, Dlaka, Nachzehrer, Zaloznye, Nosferatu … die Liste scheint unendlich.
Das Oxford English Dictionary verwendet beispielsweise sieben Seiten, um einen Vampir zu definieren, aber der älteste Eintrag aus dem Jahr 1734 ist hier am interessantesten: Diese Vampire sollen die Körper von Toten sein, belebt von bösen Geistern, die nachts aus den Gräbern steigen, den Lebenden das Blut aussaugen und sie dabei vernichten.
Diese frühen Wiedergängerfiguren haben offensichtlich wenig Anziehungskraft. Im Gegensatz zu Lord Byrons aristokratischen englischen Vampiren sind diese frühen folkloristischen Vampire Bauern und wirken eher wie moderne Zombies. Agnes Murgoci hat diesen Volksglauben weiter erforscht. Sie erklärte 1926, dass die Reise ins Jenseits gefährlich sei – nach rumänischem Glauben dauert es 40 Tage, bis die Seele des Verstorbenen das Paradies betritt. In einigen Fällen wird angenommen, dass sie jahrelang dort verweilt, und in dieser Zeit gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie verstorbene Familienmitglieder dem Vampirismus verfallen können.
Es wurde vermutet, dass der Tod als Junggeselle, durch Selbstmord oder Ermordung dazu führen könnte, dass eine Person als Vampir zurückkehrt. Bestimmte Ereignisse nach dem Tod könnten eine ähnliche Wirkung haben – eine frische Brise, die über den Leichnam weht, bevor er begraben wird, Hunde oder Katzen, die über Särge laufen, oder Spiegel, die in dieser prekären Zeit nicht gegen die Wand gedreht wurden.
Der literarische Bereich
Es war eine Abhandlung des französischen Mönchs Antoine Augustin Calmet aus dem Jahr 1746, die Schriftstellern den Zugang zu einer Reihe von Begegnungen mit Vampiren ermöglichte. Calmet ließ sich von Joseph Pitton de Tournefort inspirieren, einem Botaniker und Forschungsreisenden, der 1702 auf Mykonos einer Plage blutsaugender Vampire begegnet sein wollte. Sein Bericht wurde noch 1741 viel gelesen.
Drei Jahrzehnte nach Tourneforts Begegnung berichtete das London Journal 1732 von einigen Untersuchungen über „Vampire“ in Madreyga in Ungarn (eine Geschichte, die später von John Polidori erzählt wurde). Griechenland und Ungarn stehen in diesen frühen Berichten im Vordergrund – und das spiegelt sich in der romantischen Literatur wider: Lord Byron zum Beispiel macht Griechenland zum Schauplatz seiner unvollendeten Vampirgeschichte „A Fragment“ (1819).
Polidori war es jedoch, der den Stammbaum des Vampirs und seine soziale Stellung schuf. Vor dem aristokratischen Vampir Lord Ruthven von 1819 scheint es noch keinen urbanen oder bildungsbürgerlichen Blutsauger gegeben zu haben. Auch eine räuberische Sexualität wird vom Autor eingeführt. Zum ersten Mal sehen wir den Vampir als Wüstling oder Libertin, als echten „Lady Killer“ – eine Tendenz, die sich bis in unsere Zeit verfeinert hat. Später folgten James Malcolm Rymers „Varney the Vampyre“ (1849) und Ende des 19. Jahrhunderts „Dracula“ (1897). Zwar gab es schon vorher Vampire in der Literatur – zum Beispiel das Gedicht „Der Vampir“ von Heinrich August Ossenfelder aus dem Jahr 1748 und Christabel von Samuel Taylor Coleridge aus dem Jahr 1816 -, aber keiner von ihnen hat so viel Aufmerksamkeit erregt wie Polidoris Werk und sicherlich hat keiner so viel zu seinem Image beigetragen.
Varney hat die zweifelhafte Ehre, in dieser Aufzählung der Sonderling zu sein, denn erstens hat er durch seine Veröffentlichung in den „Penny Dreadful“-Heften weniger literarischen Ruhm erlangt als die anderen, und zweitens sind Varneys Heldentaten, anstatt sich als ein charmanten Vampir zu präsentieren, der mit der viktorianischen Vision der Schauerliteratur verbunden ist, erschreckend genug, um gut zum „Horror“ der Groschenhefte zu passen. Da sich die Darstellung der Vampire jedoch eher in Richtung Gothic als in Richtung Groteske entwickelte, waren unsere Vampirfreunde anfangs vornehme Leute, oft sogar Aristokraten. Vampire sind edel, das ist eine allgemein akzeptierte Vorstellung. Es gibt Ausnahmen (es gibt immer Ausnahmen!), aber es ist eine nachvollziehbare Faustregel. Die Erhebung des Vampirs in den Quasi-Adelsstand begann mit dem Erscheinen von Polidoris „Der Vampyr“, das ursprünglich mit dem irreführenden Untertitel „Eine Erzählung von Lord Byron“ veröffentlicht wurde. „Der Vampyr“ verdankt einen großen Teil seiner Popularität der Berühmtheit Byrons, und man kann sagen, dass die beiden Figuren untrennbar miteinander verbunden wurden. Diese Vorstellung hat bis heute überlebt, was sich unter anderem in Romanen über Byrons Leben als Vampir und in Geschichten über die Entwicklung des Vampirs zeigt, in denen der Dichter immer wieder auftaucht.
Die Anziehungskraft des Vampirs (den Ruthven damals als aristokratische Figur darstellte, der Charme und Verführung ausstrahlte) wurde erst durch den Skandal um die Veröffentlichung von „The Vampyre“ auf ein allgemein anerkanntes Niveau gehoben. Wäre Ruthven nicht zum Synonym für Byron geworden und hätte nicht jede Frau den Dichter kennen lernen wollen, der – wie es schien – die lebende Verkörperung seines eigenen todgeweihten Helden war, so wäre das öffentliche Interesse an Polidoris Roman wahrscheinlich nur von kurzer Dauer gewesen, denn sowohl „Der Vampyr“ als auch Polidori galten bald als „vulgäre Angelegenheit“. Zu vulgär für die spießige viktorianische Mittel- und Oberschicht. Vulgär, weil er „unchristlich“ war; vulgär, weil er zu „sexy“ war: Der Vampir war zu lieblich und reizvoll für seine Zeit, weshalb er gänzlich in die Gothic (und Erotik(!)-Literatur verbannt wurde. Das erklärt natürlich auch, warum der Vampir in der Gothic- und Urban-Fantasy zu Hause ist.
Der vermenschlichte Vampir
In der Tat ist das Vermächtnis von „The Vampyre“ eher ein Zeugnis von Byrons prominenten Wechselfällen und gleicht eher einer literarischen Verunglimpfung des Dichters als einem gotischen Vampirmärchen. Dies zeigt, dass der Vampir regelmäßig eher als Metapher für menschliche Entsprechungen und Beziehungen denn als übernatürliche Schreckensgestalt verwendet wurde. Der Vampir wurde also zu einer Person, und in Bezug auf seine literarische Stellung sollte er nie wieder derselbe sein – zumindest nicht innerhalb des Genres und der davon abgeleiteten Gattungen, in denen seine Identität wirklich ausgearbeitet wurde. Einmal „vermenschlicht“ – weit entfernt vom mondgesichtigen, leichenblassen Vampir, der beim Anblick einer ungeschützten Jungfrau zu triefen beginnt, wie es im reinen Horrorgenre üblich war -, ließ sich der Vampir nicht mehr von seinem Thron stoßen, und obwohl es immer wieder Darstellungen des Vampirs in einem weniger schmeichelhaften Licht geben wird, bleibt das Bild, das uns die englische Romantik so großzügig hinterlassen hat, ein fester Bestandteil unserer Kultur.
Tatsächlich eröffnete sich eine ganze Welt von Möglichkeiten, als der Vampir aufhörte, ein Abbild des Bösen zu sein, und sich in einen echten Menschen mit einem echten Leben verwandelte. Vampire können lieben, hassen, töten, zaubern, mit Schwertern oder Pistolen kämpfen, Werwölfe sind ihre Feinde, Königreiche verteidigen, Verbrechen aufklären und die Straßen der dunklen, gesichtslosen Metropolen bewachen. Vampire sind allgegenwärtig, nicht nur in der Urban Fantasy, in der das Paranormale und Übernatürliche allgegenwärtig ist. Von Malum in Mark Charan Newtons „Stadt der Verlorenen“ bis hin zu Anne Rice‘ Lestat scheint der Vampir eine Figur zu sein, die wie ein Rädchen in die Umgebung passt, in der sie sich befindet. Ob es nun an der Popularität der Twilight-Saga (Meyer, 2005-2008) liegt, am Mainstream-Appeal der verfilmten Serie „True Blood“ oder einfach daran, dass der Vampir wieder en vogue ist, eine Art Vampir-Revival hat in allen literarischen Genres stattgefunden.
Das ist nicht unbedingt neu, aber da es sich um ein langlebiges Phänomen handelt, verdient es Aufmerksamkeit. Dasselbe gilt für Zombies und Werwölfe, aber ihre Geschichte ist anders und bei weitem nicht so bipolar wie die des Vampirs. In gewissem Sinne erleben diese „Charaktere“ kein Wiederaufleben ihrer Popularität, sondern werden lediglich als nützliche Figuren anerkannt, mit denen sich interessante und abwechslungsreiche Handlungen aufbauen lassen, die zwar ein bestimmtes Genre verkörpern, aber auch kurze Anspielungen auf andere Genres enthalten. Ein Vampir ist per Definition ein Element der Fantasy, da er entweder mythisch, übernatürlich oder einfach nicht existent ist. Das bedeutet nicht, dass jede Geschichte, in der ein Vampir vorkommt, automatisch Fantasy ist, aber es bedeutet zumindest, dass sie für Fantasy-Fans interessant sein könnte.
Elizabeth Kostovas „Der Historiker“ (2005) und John Ajvide Lindqvists „So finster die Nacht“ (2004) sind gute Beispiele dafür, wie der Vampir nahtlos in die „erwachsene“ Fiktion übergehen kann, während verschiedene Manga- und Anime-Neuerzählungen des Vampirs uns daran erinnern, dass der Vampir für so ziemlich jeden attraktiv ist, der ihn haben will. Obwohl diejenigen, die nach einem historischen „echten“ Dracula suchen, oft auf den rumänischen Prinzen Vlad Tepes (1431-1476) verweisen, von dem Stoker einige Aspekte seines Dracula-Charakters übernommen haben soll, ist die Charakterisierung von Tepes als Vampir ausgesprochen westlich; in Rumänien gilt er nicht als bluttrinkender Sadist, sondern als Nationalheld, der sein Reich gegen die osmanischen Türken verteidigt hat.
All dies zeigt, dass die Geschichte der Vampire umstritten und unsicher ist, unabhängig davon, ob man sie aus wissenschaftlicher oder literarischer Perspektive betrachtet. Die in jüngster Zeit von Archäologen entdeckten „Vampir-Bestattungen“ stimmen jedoch mit Praktiken überein, von denen bekannt ist, dass sie auf den Glauben an den Vampirismus hindeuten (wie das Durchbohren des Körpers, das Nageln der Zunge, das Durchbohren des Herzens und das Einfügen von kleinen Steinen und Weihrauch in den Mund und unter die Fingernägel, um das Saugen und Stechen nach Blut zu verhindern). Diese „Vampirleichen“ tragen also dazu bei, herauszufinden, wie alt unser Glaube an Vampire wirklich ist. Matthew Beresford, Autor des Buches „From Demons to Dracula: The Creation of the Modern Vampire Myth“, stellt fest: „Es gibt klare Grundlagen für den Vampir in der Antike, und es ist unmöglich zu beweisen, wann der Mythos zum ersten Mal auftauchte. Es gibt Hinweise darauf, dass der Vampir aus der Magie des alten Ägypten hervorgegangen ist, ein Dämon, der von einem anderen in diese Welt gerufen wurde“.
Vampire gibt es in vielen Variationen auf der ganzen Welt. Es gibt asiatische Vampire, wie die chinesischen jiangshi (ausgesprochen chong-shee), böse Geister, die Menschen angreifen und ihnen die Lebensenergie entziehen; die bluttrinkenden bösen Gottheiten, die im „Tibetischen Totenbuch“ erscheinen, und viele andere. Die Geschichte der Vampire ist also noch nicht mit Sicherheit zu fassen, und bei der Suche nach dem Ursprung des Unholds sollten wir uns wohl an die Aussage des britischen Vampirologen Montague Summers (1880-1948) halten.