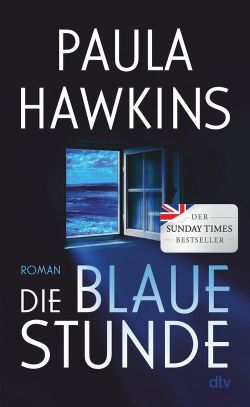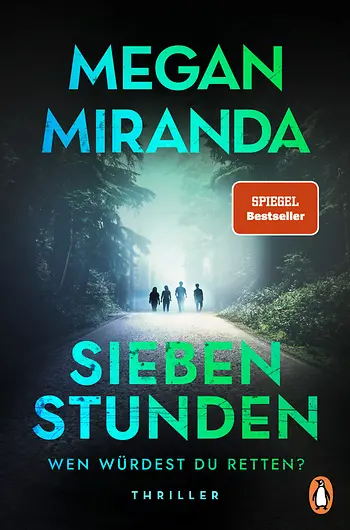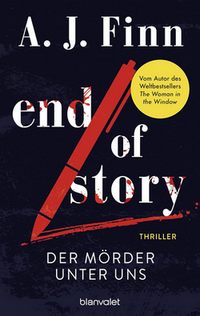Um die besonderen Bücher zu finden, insofern man sie nicht bereits in seiner Sammlung hat, ist es unabdingbar, immer weiter den Spuren zu folgen. Früher war es so, dass man dem Literaturverzeichnis folgte und sich die nächsten Stationen heraus schrieb. Des weiteren fand man – gerade in Taschenbüchern – am Ende ein reichhaltiges Register oder sogar Werbung für ähnliche Werke wie dieses, das man gerade in Hände hielt. Das bedeutet nicht, dass es heute nicht ähnlich funktioniert, aber die Trefferquote ist doch längst nicht mehr so hoch wie zu Beginn eines Leselebens, aber die Spurensuche funktioniert weiterhin überragend bei Sachbüchern, die sich sozusagen per definitionem aus angegebenen Quellen speisen.

Überlegt man sich, wie eine ausgewachsene und nennenswerte Bibliothek überhaupt zustande kommt, dann wird man zugeben müssen, dass – abgesehen vom Grundstock, den jede Bibliothek pflegen sollte, unabhängig davon, in welchen Zweig hinein sie sich später entwickelt – ein Großteil der Anschaffungen zunächst ungelesen eingeordnet wird. Man beginnt ein vielversprechendes Werk und legt es enttäuscht zur Seite, um zum nächsten Buch zu greifen. Manchmal kommt es sogar vor, das im gesamten Pulk nicht das zu finden ist, nach dem man gerade dürstet und schon mit der nächsten Bestellung zugange ist. Selbstverständlich hat man immer etwas zu lesen, es ist ganz und gar unmöglich, leer zu laufen, aber ich spreche hier von besonderen Büchern, von jenen, die sofort in den persönlichen Kanon wandern. Um so mehr Bücher auf den Markt geworfen werden, desto geringer werden die Meisterwerke, desto höher aber auch die Sichtungen, die dann den Umfang der Bibliothek merklich erhöhen.