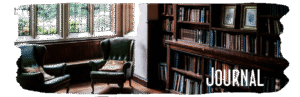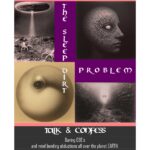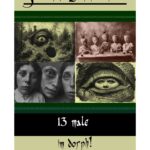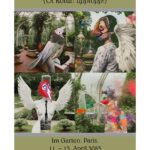Kabinettstückchen
Patricia Highsmith bewegt sich ziemlich sicher in ihren psychologischen Kabinettstücken (und natürlich auch im Kriminaldrama, das hier keine große Rolle spielt), und ihre Sprache ist zwar präzise, aber nicht gerade lyrisch. Sie berichtet, anstatt zu beschreiben, und kommt auf Satzebene fast ohne Metaphern aus. Würden sich ihre Figuren nicht ständig in psychologischen Extremen bewegen, könnte man sie als flach bezeichnen.
Und diese Figuren sind wirklich schwer, wenn nicht unmöglich, zu mögen. Graham Greene nannte die Autorin in seinem Vorwort die „Schriftstellerin der Beklemmung„, und wenn man diese Geschichten genauer studiert, erkennt man, dass sie ein Beispiel dafür sind, wie die weniger angenehmen menschlichen Eigenschaften – wie der Impuls zur Grausamkeit – wichtige Verbindungspunkte zwischen der Figur und dem Leser sein können. Das ist keine tiefgründige Beobachtung, aber die unsicheren, beleidigten, affektierten, unbehaglichen, elenden, ängstlichen, grausamen Figuren kommen nie über diese Eigenschaften hinaus. Sie haben Erfolg oder Misserfolg, meist indem sie töten oder getötet werden, aber sie entwickeln sich nicht durch ihre Erfahrungen. Highsmiths Kurzgeschichten widersetzen sich James Joyces Erwartung einer Erleuchtung: Die Menschen verhalten sich schlecht, und es gibt keine Veränderung ihres Charakters. Keine Verschiebung der Wahrnehmung, keine Wunder der Gnade. Man könnte sagen, dass für Highsmith die Veränderung des Charakters in der Regel auf eine Steigerung der eingekerkerten Fähigkeit hinausläuft. So wie ein Gefängnisaufenthalt eher zu einer fortgeschrittenen kriminellen Ausbildung als zu einer Rehabilitation führt.
Seltsame Wege
In „…. geht seltsame Wege“ zerstören zwei ältere Frauen, die es nicht ertragen können, voneinander getrennt zu sein, mit Vergnügen die wertvollsten Gegenstände der anderen – Hattie zerschneidet Alices Lieblingsjacke, ein Geschenk ihrer geliebten Nichte, und Alice rächt sich, indem sie Hatties langen Zopf abschneidet (ihre einzige Eitelkeit). Am Ende gibt es eine Entschuldigung und eine Versöhnung – diese Frauen haben verzweifelte Angst, allein zu sterben, aber jede von ihnen hegt Pläne für weiteren Vandalismus.
Was mir an Highsmith gefällt, ist ihre Widersprüchlichkeit, ihr Widerstand gegen das Gute im Menschen, ihre Fähigkeit, das Unattraktivste zum Leben zu erwecken. Und selbst wenn man die Eigenwilligkeit in Betracht zieht, die oft mit kreativem Talent einhergeht, war sie eine seltsame Frau. Sie hasste die Menschen notorisch, was man nicht einfach als Asozialität abtun kann; ihre Verachtung glich eher einer tiefen Abneigung. Sie hasste ihre Verwandten (sie verachtete sogar den Begriff Familie), und als Lesbe hasste sie andere Frauen. Überhaupt war sie nicht gerade das Postergirl der Frauenbewegung und in vielerlei Hinsicht politisch unkorrekt. Obwohl sie zahlreiche Affären mit Männern und Frauen hatte, erlaubte sie sich nie so etwas wie eine Beziehung. Sie schien von Lügen und Betrug zu leben und hatte eine Vorliebe für Spielchen, die zur Trennung von Paaren führten. Es überrascht nicht, dass sie allein in einem Krankenhaus starb, ihr Buchhalter war der letzte, der sie besuchte.
Highsmith – Die Schneckenforscherin
Zwei der elf Geschichten in diesem Band handeln von Schnecken. Das ist nicht verwunderlich, denn Highsmith war dafür bekannt, dass sie selbst etwa dreihundert Schnecken als Haustiere hielt. Dieses autobiographische Element eröffnet zwar den Band, steht aber als schwächste Erzählung etwas unglücklich am Anfang. Ein Mann beobachtet die wachsende Zahl der Schnecken in seinem Haus mit einer Neugier, die etwas von Voyeurismus hat und schließlich zur Obsession wird.
Patricia Highsmith gefiel die Tatsache, dass Schnecken geschlechtlich ambivalent sind, dass man Männchen und Weibchen nicht unterscheiden kann. Sie hielt die Tiere nicht nur zu Hause, sondern nahm sie auch auf Reisen mit. Sie versteckte sie in Käsekartons, um sie ins Ausland zu schmuggeln. Manchmal versteckte sie sie auch unter ihren Brüsten. Sie nahm sie mit zu Abendessen, wo sie sich vor den Gästen und dem Essen langweilte (es heißt, sie habe nicht nur Menschen, sondern auch alles Essen gehasst, so dass sie sich möglichst von Zigaretten ernährte). Die Schnecken reisten in ihrer Handtasche, wo sie an einem Salatkopf klebten, und sie machte sich einen Spaß daraus, die anderen zu erschrecken, indem sie sie herauszog und ihre schleimige Spur auf dem Tisch hinterließ.
Den „Schneckenforscher“ konnte sie zunächst nicht in Druck geben. Ihr Agent teilte ihr mit, die Geschichte sei „zu abstoßend, um sie irgendeinem Verlag anzubieten“. Zwölf Jahre lang lag die Geschichte, die eine Wendung ins Ekelhafte beschreibt, in der Schublade, bevor sie sie einem befreundeten Verleger verkaufen konnte
„Er war eines Abends in die Küche gekommen, um vor dem Dinner schon eine Kleinigkeit zu essen, und zufällig war sein Blick auf die Schüssel mit Schnecken gefallen, die auf dem Ablaufbrett am Spülstein stand und in der sich zwei Schnecken höchst sonderbar benahmen. Sie standen sozusagen auf dem Schwanzende und schwankten voreinander hin und her wie zwei Schlangen, die von einem Flötenspieler hypnotisiert werden. Gleich darauf berührten sich die beiden Gesichter zu einem Kuss von deutlicher Sinnlichkeit. Mr. Knopper trat näher heran und musterte sie von allen Seiten. Da geschah noch etwas: bei beiden Schnecken erschien auf der rechten Kopfseite ein kleiner Auswuchs, etwa wie ein Ohr. Was er da vor sich sah, war irgendeine Art von Sexualerlebnis, das sagte ihm sein Instinkt.“
Obwohl Patricia Highsmith eine Vorliebe für sexuell ambivalente Charaktere hat, ist dieses Paarungsritual, das noch näher beschrieben wird, die deutlichste Darstellung des Sexuellen in ihrem Werk. Nach dem Anblick der beiden Schnecken beginnt Knopperts anfängliches Schaudern in sexuelle Besessenheit umzuschlagen und erreicht ein gewisses Extrem, das schließlich zu seinem Untergang führt.
The Snails
Die zweite Schneckengeschichte ist eigentlich noch mehr eine Grusel- oder Monstergeschichte als die erste. „Auf der Suche nach X. Claveringi“ erschien zuerst in der Saturday Evening Post unter dem Titel „The Snails“. Bei den Monstern handelt es sich um fünf Meter lange Schnecken, die von Professor Clavering entdeckt werden, der hofft, dass sein Name mit ihnen in Verbindung gebracht wird („Soundso Claveringi“, daher der Titel). Die Übersetzerin Anne Uhde hat hier das „X“ einmal für „Soundso“ und einmal für das „blank“ des Originaltitels eingesetzt: The Quest for Blank Claveringi). Wie bei Knoppert ist sein Verhalten zwanghaft.
Als der Professor in ein schreckliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Mensch und Schnecke verwickelt wird, kommt das berühmte Spannungstalent der Autorin zum Vorschein. Bemerkenswert ist, dass Highsmith die in ihrem Werk übliche Trope umkehrt. Sie schreibt so oft über die Täter und nicht über die Opfer, und die Angst des Opfers ist hier ebenso faszinierend wie spürbar. Die Schnecken selbst sind berechnende Räuber, die nicht aufgeben und den Professor bis zur Erschöpfung treiben, bis er sich nicht mehr wehren kann. Sie sind gastropodische Versionen von Tom Ripley, klüger und stärker als der dem Untergang geweihte Clavering.
So furchteinflößend die Riesenschnecken auch sein mögen, die schneckenbesessene Highsmith kann es sich nicht verkneifen, auf ihre Schönheit hinzuweisen, die nur wenige Menschen an einem solchen Geschöpf bemerken. „Er hatte jetzt die linke Seite vor sich“, schreibt sie, „die Seite ohne das Spiralgehäuse. Sie sah aus wie ein pfirsichfarbenes Segel, vom Wind gebläht, und die Sonne malte silbrige und perlmuttschimmernde Flecke darauf, die glänzten und sich hin- und her wanden, als das Riesentier sich bewegte.„
Die beiden Schneckengeschichten in diesem Band sind für sich genommen solide und verdammt ungewöhnliche Schauergeschichten. Liest man sie mit etwas Hintergrundwissen über Highsmith und ihr Problem mit Menschen, kann man Graham Greene leicht zustimmen, der sagte, dass Highsmith über Schnecken mit der gleichen Distanz schrieb, mit der sie Menschen betrachtete.
Der Schneckenforscher (Eleven Stories)
„Warten“ ist die zweite Erzählung des Bandes und zeigt Highsmith in ihrer besten neurotischen Form. Es ist die Geschichte eines gestörten Mannes, dessen Enttäuschung in der Liebe eine irrationale Reaktion auslöst, die zu einer grausamen Täuschung führt.
Besessen von dunklen Themen in ihrem gesamten Werk, wurde auch diese Geschichte stark von einem schmerzhaften Moment in Highsmiths eigenem Liebesleben inspiriert. Nach einer glücklichen Affäre mit der englischen Ärztin Kathryn Cohen während eines Italienurlaubs im Sommer 1949 kehrte Patricia Highsmith nach New York zurück und begann ihr zu schreiben. Jeden Tag wartete sie auf Kathryns Antwort, die nie kam. Ihre inneren Qualen fanden Eingang in die Seiten dieser Geschichte, in der Don von einer Urlaubsromanze mit Rosalind zurückkehrt und ihr in einem Brief mitteilt, dass er sie heiraten möchte. Als sie nicht antwortet, vergewissert er sich, dass der Brief nicht versehentlich bei seinem Nachbarn gelandet ist. Er bricht den fremden Briefkasten auf und findet einen Brief, den eine liebeskranke Frau namens Edith geschrieben hat. Don nimmt die Identität seines Nachbarn an, antwortet Edith und verabredet sich mit ihr an der Grand Central Station. Schließlich antwortet Rosalind und lehnt Dons Heiratsantrag ab. Don ist niedergeschlagen und macht sich auf den Weg zum Hauptbahnhof, um Edith zu treffen.
„Die Geschichte handelt so sehr von K und mir“, schrieb Highsmith später in ihr Tagebuch.
Sie wurde erst 1968 im Ellery Queen Mystery Magazine veröffentlicht, bevor sie Teil der vorliegenden Sammlung wurde.
In der Erzählung „Die Schildkröte“ löst die Tötung des titelgebenden Tieres, das zu einem Eintopf verarbeitet werden soll, einen Muttermord aus. Der junge Protagonist hält die Schildkröte zunächst für ein Geschenk seiner Mutter. Entsetzt über die Tötung und Zerstückelung des Tieres, überkommt ihn der Groll und er ersticht seine Mutter.Es ist nicht verwunderlich, dass der Junge eine besondere Vorliebe für psychologische Bücher hat, darunter Karl A. Menningers „The Human Mind“, denn als Highsmith im Alter von neun Jahren dieses Buch in der Bibliothek ihres Stiefvaters fand, war sie von den Fallgeschichten über psychische Krankheiten und abweichendes kriminelles Verhalten so gefesselt, dass ihre Fantasie für immer von irrationalen Trieben, die zu Gewalt und Selbstzerstörung führen, gefesselt blieb. „Die Schildkröte“ ist eines von vielen Beispielen, in denen Highsmith zeigt, dass ihre besondere Stärke in der Darstellung von Geisteskrankheit liegt. Wie in vielen ihrer Kurzgeschichten herrscht auch in „Die Schildkröte“ eine erdrückende Atmosphäre von Zerrüttung und Verwirrung.
Eine andere Geschichte in dem Buch, „Als die Flotte im Hafen lag“, beginnt mit einem wunderbaren Satz: „Mit der Chloroformflasche in der Hand starrte Geraldine auf den Mann, der schlafend auf der Veranda lag“. Wir wissen natürlich, dass es in dieser Geschichte kein Happy End geben wird. Der Mann ist Geraldines eifersüchtiger Ehemann, der glaubt, dass sie mit jedem Mann, mit dem sie auch nur den geringsten Kontakt hat, eine Affäre beginnt. Außerdem ist er gewalttätig, so dass sie es als Befreiung empfindet, ihn zu töten. Sie flieht aus dem Haus, in dem sie wie eine Gefangene gehalten wird, ohne zu wissen, dass ihr Mann das Chloroform überlebt hat. Am Ende der Geschichte wird sie von der Polizei aufgegriffen, aber nicht wegen versuchten Mordes angeklagt, sondern als vermisst gemeldet – eine brillante Verdichtung einer schäbigen und tragischen Situation. Bruchstückhaft und in Andeutungen erfahren wir von ihrer Vergangenheit, während die Geschichte voranschreitet. Highsmiths Stil ist von einer beiläufigen Sanftmut geprägt, aber das ist Kalkül, denn sie will, dass wir uns mit dieser verletzten und psychisch instabilen Frau auseinandersetzen, bevor sie das katastrophale Ende herbeiführt.
1946 gewann die Story „Die Heldin“ über eine gestörte Gouvernante den 0. Henry Award für das beste Debüt, und tatsächlich ist diese kurze Erzählung bereits voll ausgebildet. Hierzu passt die Aussage von Paul Theroux:
„Highsmiths Genie liegt in der Darstellung des Paradoxons der Fantasie: Erfolge sind nicht das, was sie scheinen. Wo im traditionellen Märchen die Heldin die Kröte in einen Prinzen verwandelt, wird in Highsmiths Fabel der Prinz zur Kröte – der Erfolg ist fast immer tödlich. . . . Die Kombination der besten Eigenschaften des Suspense-Genres mit dem Besten der existenziellen Erzählung spiegelt sich hier – die Geschichten sind in jedem Sinne des Wortes phantastisch.“
Eine der eindringlichsten Erzählungen des Bandes ist „Auf der Brücke“, das Porträt eines Mannes, der nach einem Trauerfall und einer dadurch ausgelösten Identitätskrise in der Fremde, die ihm doch nicht ganz fremd ist, umherirrt. Obwohl er sich fremd fühlt und es in weiten Teilen auch ist, zieht ihn die Erinnerung an die Zeit seiner Flitterwochen in einem Garten in Italien an. Der Wechsel zwischen vergangener Vertrautheit und anonymer Fremdheit korrespondiert mit einem Selbstmord, den er beobachtet, als er zu Beginn der Erzählung in einem Taxi über eine Brücke fährt. Eigentlich ist der Originaltitel „Another Bridge to Cross“ aussagekräftiger, Patricia Highsmith nannte es eine „tragische Geschichte, die ich aus meinen eigenen Gefühlen heraus geschrieben habe“. Sehr schön zeigt sie hier eine innere Leere, die im Kontrast zur lebendigen Welt steht. Alle Versuche Merricks, das Leben nicht aus den Augen zu verlieren, scheitern, bis er schließlich den Garten nicht mehr verlässt.