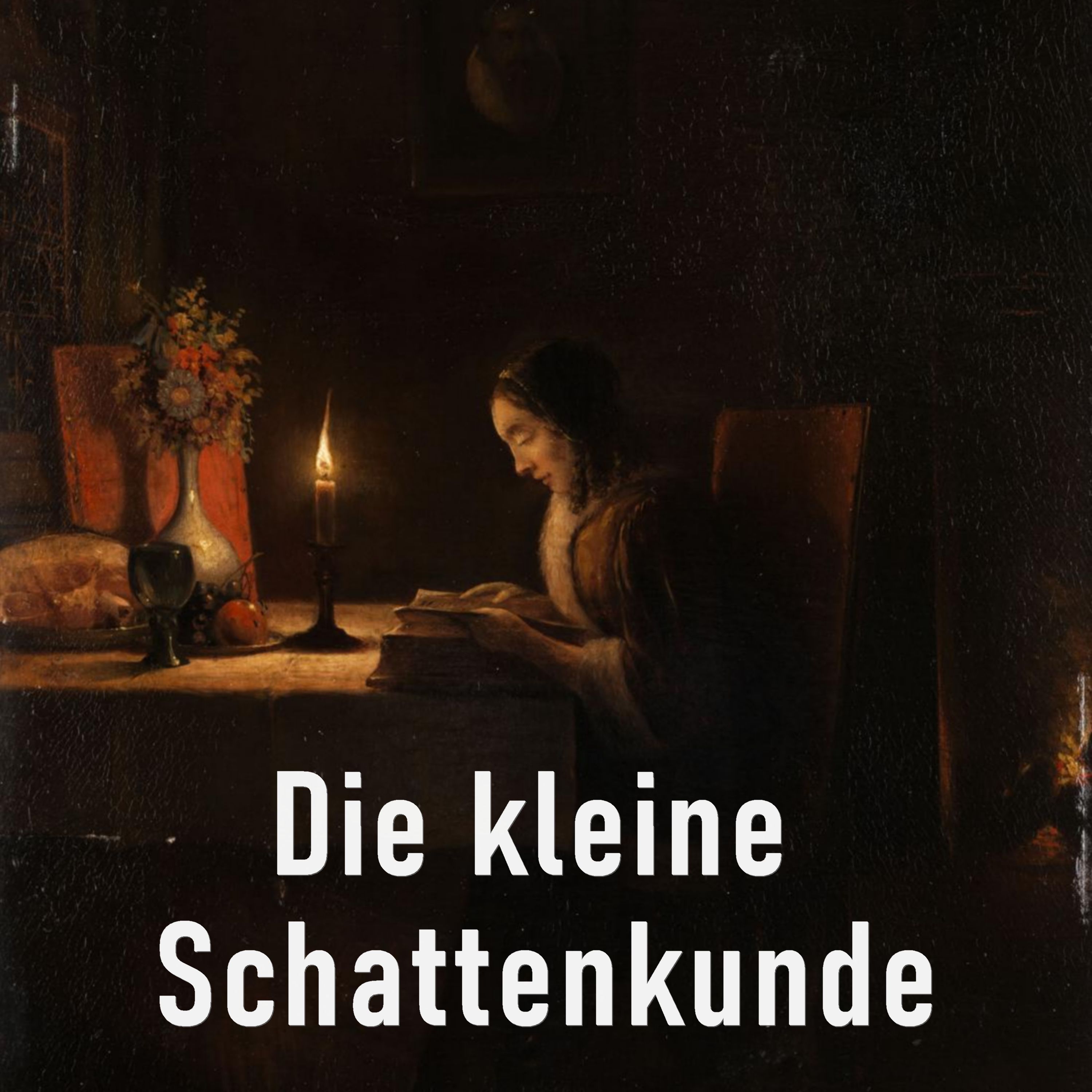Oscar de Muriel führt sein Ermittlerduo Frey & McGray im zweiten Fall (zum ersten) noch tiefer in die Grauzonen zwischen Rationalität und Aberglauben. „Der Fluch von Pendle Hill“ ist zugleich viktorianischer Polizeithriller, Folk-Horror und Milieustudie über Medizin, Macht und Mythen – temporeich erzählt, atmosphärisch dicht und mit spürbarer Lust am Schauerroman, aus dem sich der Kriminalroman ja dann auch herausschälte.
Neujahr 1889: In der Irrenanstalt von Edinburgh gelingt einem Patienten die Flucht, eine Krankenschwester stirbt – und die sture, scharfzüngige Lokallegende „Nine-Nails“ McGray sowie der nüchterne Londoner Exilant Ian Frey nehmen die Verfolgung auf. Der Fall ist von Anfang an von Gerüchten über Okkultes umflort; die Spur führt schließlich über verschneite Landstriche hinweg in den Schatten von Pendle Hill, dem sagenumwobenen Schauplatz der Lancashire-Witchcraft-Prozesse.