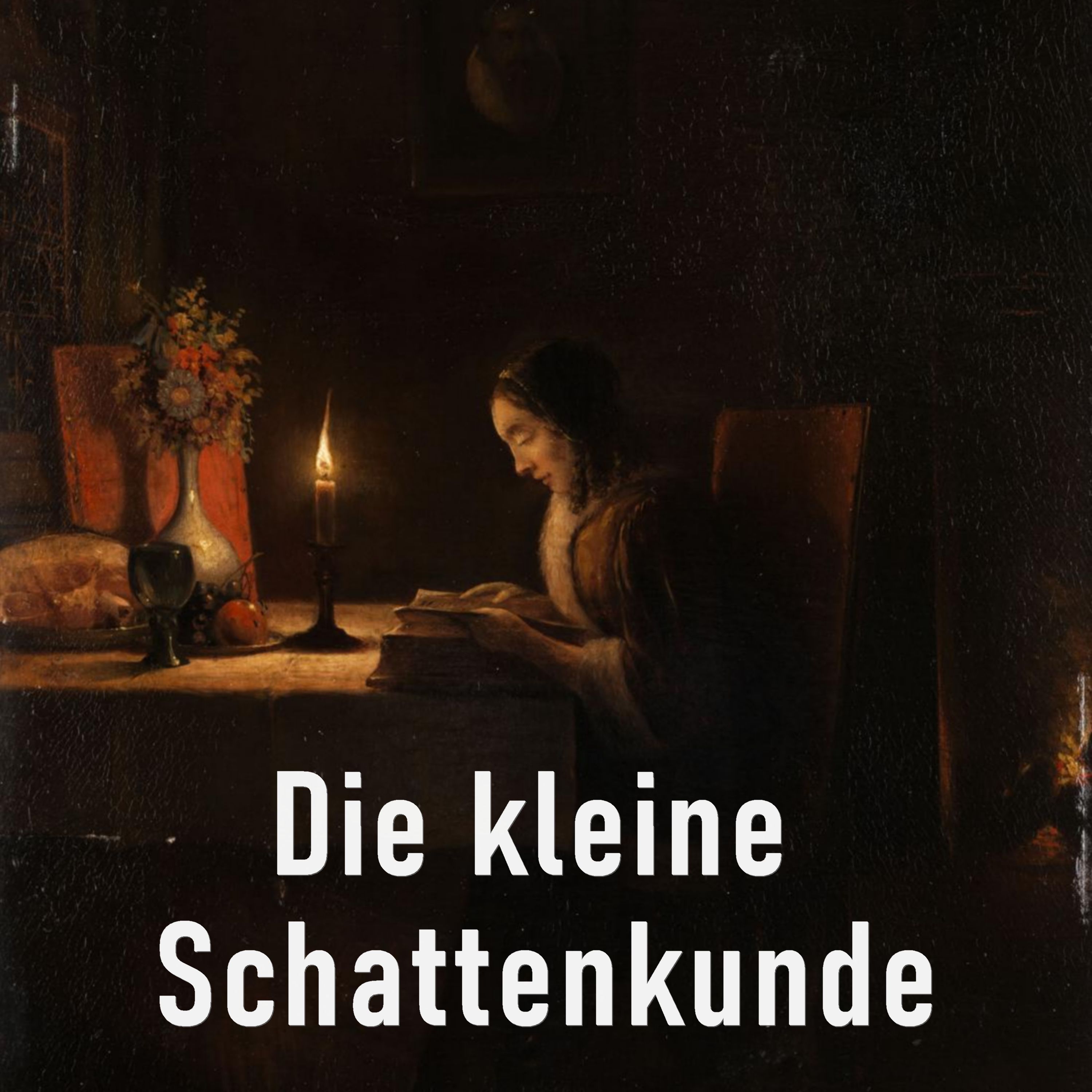Warum nicht noch einmal einen Podcast versuchen. Es wird sich wieder um einen handeln, der sich nicht dadurch auszeichnen wird, viel gehört zu werden (wenn überhaupt). Da ich allerdings seit Jahrzehnten mit der Audioperspektive arbeite (begonnenen 2005 mit der Sammlung „Ouroboros Stratum“) und die vielen Versuche mich bis heute unkommodiert zurück lassen, müsste ich die nächste Stufe vorbereiten.
Als mein Weblog 2006 in Die Veranda umbenannt wurde, lief er ein ganzes Jahr unter dem Namen „work in progress“ – eine Reminiszenz an den Ulysses von James Joyce, aber völlig passend für meine Literatur des ewigen Tanzes, der ewigen Veränderung, aus der Fertiges nur herausgeklaubt wird, um es in Druck zu geben. Es wäre von innerer Ignoranz zu sprechen, würde ich nicht zugeben, dass ich nicht verschiedene Bücher schreibe, sondern immer wieder denselben inneren Raum zu betrete, auch wenn dieser Raum mit seinen vielen Spiegeln und Masken die Unendlichkeit markiert.
Es sind dieselben Fragen, Symbole, Motive, Obsessionen – und jede Veröffentlichung ist nur ein weiteres Fenster zu diesem inneren Kontinent, ein geschlossenes Imaginarium mit wiederkehrenden Orten, Bildern, Mustern, oft metaphysisch, traumhaft oder existenziell. Das eigentliche Buch entsteht nie ganz; es nähert sich nur an. Ich bin dem asymptotischen Schreiben verfallen.
Es fühlt sich an, als schreibe ich nicht Texte, sondern ein Bewusstsein, das sich ein Leben lang erforscht. Hier ist das Bild das ich benutzen werde:
Das Original stammt von Petrus van Schendel, ein niederländisch-belgischer Genremaler der Romantik, der sich auf nächtliche Szenen spezialisiert hatte, die durch künstliches Licht wie Kerzenlicht, Lampen oder offenes Feuer beleuchtet wurden, und heißt dann auch – wie sollte es anders sein – „Lektüre bei Kerzenlicht“.
Ich bin mir natürlich bewusst, dass diese Privatdinge auch Privatdinge bleiben; es gibt schlicht keinen Grund, irgendetwas zu tun, außer die Notdurft zu akzeptieren, gegen die man ohnehin kaum einen Kampf gewinnt. Ricardo Piglia hat es in seinem Roman MUNK so dargestellt
„Sie wissen, dass sich dort draußen kein Mensch für Literatur interessiert und sie die letzten verbliebenen Hüter einer glorreichen, in die Krise geratenen Tradition sind.“
Ich werde an entsprechender Stelle darauf zurückkommen.
Im Grunde gab es in meiner Arbeit drei wichtige Annäherungen. Die poetische Sprache sollte auch in Prosa möglich sein; ein Tagebucheintrag sollte davon nicht ausgenommen werden; wie kann man das, was man erlebt, jemals in Worte fassen.
Ein Audiokunstwerk ist im Grunde kein Podcast, das dürfte niemand bestreiten. Ich glaube, man hat auch von Radiokunst gesprochen – und wenn man das Wort Radio heute noch so benutzen würde, wäre es mir recht. Also: Strahlenkunst. Noch früher sicher: Speichenkunst.