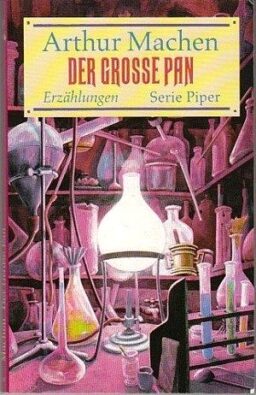In einer wilden Zeit (wenn das Leben ew’ge Wirrnis ist), soll und kann man Erlösung dort finden, wo früher Verbote den Äther verstopften, als Hinweis quasi, zu tun, was andere vielleicht nicht tun. Das Gute daran: Ich wollte nie auf einem öffentlichen Spielplatz spielen, sondern immer nur auf einem privaten. Wie gut, dass es die noch gibt.