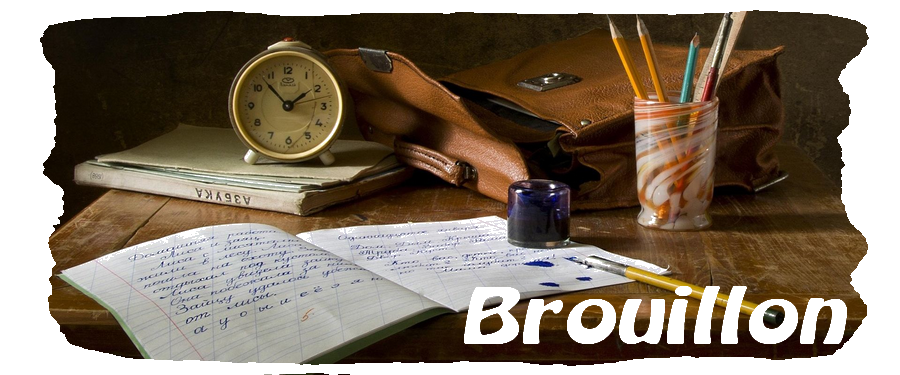Zwischen dem Wort „Toilette“ und dem Wort „Leute“ gibt es eine ungemeine Verwechslungsgefahr. Doch der ähnliche Klang kommt nicht von ungefähr. Immer, wenn ich „auf die Toilette muss“, dann mache ich das, was Raben tun, wenn sie „auf die Leute
“, nämlich: scheißen.
„Ich muss mal kurz auf die Leute“, ist dann das Ergebnis einer gepflegt realistischen Wortwahl.
Brouillon
der BROUILLON ist tagesgeschäft, nicht mehr als journaling über unwichtige persönliche befindlichkeiten.
Befreiung von Zweck
„Wenn nun ein höherer Mensch über das geheime Wirken und Walten der Natur eine Ahnung und Einsicht gewinnt, so reicht seine ihm überlieferte Sprache nicht hin, um ein solches von menschlichen Dingen durchaus Fernliegendes auszudrücken. Es müsste ihm die Sprache der Geister zu Gebote stehen …“ (Goethe)
Als ich ansetzen wollte zu einem Hohelied der Geistersprache, gerate ich an Heinz Schlaffers ebenso benanntes Buch, 2012 bei Hanser, gerate dann wieder in die Situation, erst einmal widersprechen zu wollen, mäßige mich aber, weil dem Lyriker bewusst sein muss, dass er sich einer archaischen und vollkommen autonomen Form anheimgibt, indem er auf Kommunikation mit seiner Umwelt pfeift und pfeifen muss, indem er davon profitiert, was ein jahrhundertelanger Kampf war, Herr (und Dame) über sein Kunstwerk zu sein, zum ersten Mal wirklich frei (nun jetzt schon etwas länger), aber auch nicht zu lang, wo messen wir schließlich, wir messen 1 am Kosmos, wir messen 2 dann erst am pille-palle-existierenden Menschen(ge)schlecht. & wenn die Götter das hören, werden sie dachsteufelslustig, denn sie haben’s ja schon immer gesagt, wo sind denn ihre Schamanen hin, ihr Joghurtesser und Baumhöhlenbewohner, wo sind die denn hin in ihren Betongsiedlungen. & wem hören sie da zu. & wollen zu allem Abfluss auch noch gelesen werden. Das Sangesfeuer ist die Inspiration, Begeisterung hört sich da nicht schön an, Besessenheit ist besser, herausgefallen aus dem Geniekult, der aber im Kleinen weiterschlüpft, herausschlüpft aus dem Kescher, dämonisches Werden, ganz anders sein, weil da zu trennen ist zwischen dem wie ich sein könnte und dem wie ich werde. Befreiung von Zweck, aufatmen : sooooog; ausatmen : faaaach!
Wir preschen die Spuren
Nur die Lyrik ist dazu imstande, uns zu befreien. Dass wir überhaupt befreit werden müssen, daran ist ein Phänomen schuld, das wir „modern“ nennen. In Wirklichkeit meinen wir jedes Mal, wenn wir dieses Wort benutzen „Entfremdung“, und doch lässt sich mit dieser Entfremdung hervorragend arbeiten, vor allem, wenn wir akzeptieren, dass wir niemals irgendwohin zurückkehren können. Wir alle sind den Orten unserer Vergangenheit fremd. Indem wir über Vergangenes nachdenken, verfremden wir die Vergangenheit, bedienen uns eines Stilmittels, das im Gedicht sein Königreich erfährt. Das ist ein Vorgang der Evokation, unser Gedächtnis ist ein Schuttgedächtnis, und wir rufen uns in Erinnerung, was wir längst nicht mehr parat haben, das aber unsere Träume beeinflusst, die wiederum ein Gefühl in uns zurücklassen, als hätten wir etwas Bedeutsames vergessen. Wir erinnern uns an die Lücken des Gewesenen, treffen also mit der Gabel nie das Fleisch, das uns stets entwischt, obwohl der Teller endlich scheint. Natürlich: auch das ist immer nur Schein. Wir preschen in die Spuren, die wir selbst nicht angelegt haben.
Vashti Bunyan: Train Song
Tatsächlich ist die Frühe ein Schauspiel Eiter-entzündlicher Wolken, tiefliegender Bewässerung, die gestern begann und mit einem rasanten Trommelfeuer eisiger Kleinbrocken die Straße kurz in einen Bach verwandelte. Nichts gegenüber den überschwemmten Tälern, die es im Sommer in anderen Regionen gab, aber ich dachte kurz an meine Bücher im Keller. Der ist über der Waschküche jedoch höher gelegen, ungefährlich, so lange nicht das völlige Szenario einer Kapitalisten=(statt „Sint=“)Flut ausbricht. Der Sommer, der dieses Jahr ekelhaft war, neigt sich dem Ende, das ist bereits anhand von Kleinigkeiten zu spüren. Kein Freund der klimatischen Massenunterhaltung bin ich. Wollte mir um 6 nur das Wasser abschlagen, da war Albera schon auf die Gleise konzentriert -gen Klondike in der Falz – Goldmeuble abzuholen. Blieb dann aber wach, nachdem ich gestern vor lauter Hitzemigräne nicht an die Sandsteinburg konnte. Nun, es wird spät in den letzten Wochen, spät wie jahrelang nicht (ich bin doch meist zwischen 8 und 9 gestartet; jetzt wird es öfter auch 10 oder 11 weil nachts 2 oder 3). Nachher aber Flohmarkt (und Paket vom DHL, der gestern wieder mal nur einen Zettel hinterließ … ich brauche dem Post=Diener wohl zu lange, bis ich aus meiner Kemenate heruntergestiegen komme).
Zum Sandsteinburg-Soundtrack:
Die Kraft einer an sich einfachen Aussage, die ihre Wucht durch die Repetitio bekommt, wie sie ja in solchen Beispielen nicht gerade selten ist. Der Text aber wäre banal, wenn ihn nicht dieser ferne Gesang zu einem atmosphärischen Ungeheuer machen würde, ihm einen emotionalen Schub verpassen würde. Der Vortrag gibt perfekt das wieder, was der Text bedeutet, und zwar in seiner nackten Vollendung.
Travelling north, travelling north to find you
Train wheels beating, the wind in my eyes
Don’t even know what I’ll say when I find you
Call out your name, love, don’t be surprised
It’s so many miles and so long since I’ve met you
Don’t even know what I’ll find when I get to you
But suddenly now, I know where I belong
It’s many hundred miles and it won’t be long
Nothing at all in my head, to say to you
Only the beat of the train I’m on
Nothing I’ve learned all my life on my way to you
One day our love it’s over and gone
It’s so many miles and so long since I’ve met you
Don’t even know what I’ll find when I get to you
But suddenly now, I know where I belong
It’s many hundred miles and it won’t be long
Unübersehn
O Umzug. O nein. (Es musste so kommen.)
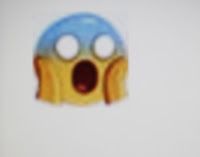
So kam es. Und nun ist es soweit. Weiß ich doch seit Wochen. Mit der Tschu Tschu geht’s in die Pfalz. Mit nem großen grünen Stegosaurier zurück. Den Stego vermute ich mal, da ich nur die ‚kleinen‘ Busse kenne, von dem, der ihn mir zur Verfügung stellt und wohl auch fährt. Obwohl ich das auch machen würde. Ich fahre ja hin und wieder der Arbeit wegen einen Bus. Hey Busfahrerin! Aber eben einen ‚kleinen‘, der maximal 10-15 Personen fasst. Das wollte ich mal zu meinem Beruf machen. Ist noch gar nicht so lange her, da stand das zur Debatte.
Hab‘ uns heute auf dem Viehmarkt nen 2-kg-Sack Zwetschgen gekauft. Zum Frühstück gab’s Debreziner mit Kaisersemmeln und Senf. Die Zwetschgen brauchen noch, sind noch recht fest und sauer. Bis sie zart und süß sind, bin ich wieder da. Mit Fahrrad. Um in irgendeiner Weise wieder mobil zu sein. Das Fahrrad, mit dem ich, bevor ich zu dir kam, die letzten Tage zu meiner alten Arbeitsstelle geradelt bin, vorbei an Felder, Felder und noch mehr Felder. Du hast mich zu dir geholt. Bist Tschu Tschu gefahrn. Kamst an auf Gleis 2. Mich am Ohr.

Wir übernachteten im Mannheimer Maritim-Hotel, in dessen Korridore wir uns immer wieder verliefen, das uns stark an das Overlook-Hotel erinnerte. Es schien auch genauso leer, wir beide waren um kurz vor Mitternacht die einzigen, die noch die Bar aufsuchten. Es war uns ein Haus mit einem ganz eigenem Willen, das einen vergessen macht, in welcher Stadt man ist, zu welcher Jahreszeit, zu welcher Zeit überhaupt. Solche Häuser wirken auf mich wie Uterushäuser. Die Welt herum versinkt ins Dunkel, ist nicht mehr existent, wandelt man durch solche Gänge, schläft und isst in ihnen. Abnabelung durch eine totale In-sich-Aufnahme. Wir spürten, dass wir absorbiert wurden. Waren wie in einer dickwandig ausgekleideten Blase, die die Welt nur als ein Innen kennt. Keine Sinne der Gewohnheit. Es war mir als ob ich ständig meinen eigenen Puls schlagen hörte. Meine Ohren waren wie nach innen gestülpt. Die Farben teilten sich in einer ganz anderen somatischen Sprache mit. Die Klänge hatten etwas Gedämpftes. Ähnlich: sich in eine Badewanne zu legen und die Ohren unter Wasser zu halten. Noch immer hört man etwas, aber es scheint ein Klang, eine Akkustik einer anderen Welt zu sein. Und wie Wasser mir hierfür ein Medium ist, war es auch dieses Haus, das wir beide vielleicht irgendwann in der Zukunft noch einmal besuchen werden. Doch dann mit einer Kamera.
Manusprickt
Noch habe ich den Katarrh und bin im Verzug mit den Sandsteinburg-Lesungen, das Manusprickt bearbeite ich jedoch ausgiebig. Der Beiname „Possenspiel“ ist jetzt das offizielle Element dieser multiplen Dampframme. Ich muss gestehen, dass ich die Sandsteinburg nie fertig zu machen beabsichtigt hätte, wenn nicht Albera seit einem Jahr die Weichen stellte. Oft hatte ich den Text in seine nahezu 1000 Einzelteile zerlegt, selbst überzeugt von der Unmöglichkeit dieses „absoluten Buches“, manchmal ertappte ich mich dabei, dass ich an einen idealen Leser dachte, überhaupt an Leser, was ich mir jedoch erfolgreich wieder austreiben konnte. Es geht um Kunst und nicht um Leser. Zwei Begriffe also, die sich beißen. Man darf nicht feige sein, wenn man sein Leben ausschließlich der Literatur widmet, wenn man selbst ein Kunstwerk ist und man jegliche Grenzen schon vor Jahrzehnten überschritten hat. Aber es ist die Eger mein Rubikon. Und es ist die Sandsteinburg meine Nemesis.
Kühleborn, ein Quantenpoet und eine Ogerin im Elfenkostüm
Obwohl ich nun abgrundtief müde bin, bin ich wohl für den Rest des Tages glücksselig. Hatte meine Freude euch beide zu beobachten, dich und Schwarzertd, wie ihr von Anfang an, ohne große Scheu und allzu vorsichtiges Tasten nach dem Anderen, in den Diskurs miteinander gegangen seid. Zum Schluss saßt ihr gar dicht beieinander. Zwei am Tisch auf einer Gerade. Und habt mich stets angegrinst. Erreichtet den Höhepunkt als ihr gemeinsam vor deinem Bücherregal standet und beide einen Arm ausstrecktet, nach einem Werk Arno Schmidts zu greifen. Hätte ich heimlich eine Kamera laufen lassen, hätte ich nun einen Mitschnitt eines literarischen Duetts wie ich es allenfalls noch erlebe, habe ich eines mit dir oder mit ihm. Etwas, das bei den ollen Qua(r)kquartetten in der Flimmerkiste unter ferner liefen läuft. Denn liefe das, müsste man sich eingestehen, this, was da heute gesendet wird: goes not! Geht aber doch: Etwas, das, bin ich gerade lull und lall, und auch nur dann, höchstens noch schabernackig auf mich wirkt. Doof und halbseiden. Grotesk aufgrund der ernsthaften Miene, mit der man vorträgt, was man von sich und dem Leseerlebnis zu berichten hat.
Ich hatte Schwarzertd seit über einem Jahr nicht mehr gesehen, nur hin und wieder mit ihm telefoniert. Und nun, da er sich gerade aus beruflichen Gründen in München aufhielt, hat er die Gelegenheit genutzt, uns zu besuchen. Seine Stimme hörte sich zum ersten Mal anders für mich an, was nur daran lag, dass er die letzten Tage beim Schreiben viel geraucht hat. Wie ein Schlot wohl. Was in früheren Zeiten doch eher mein Part war. Früher. Denn ich rauche ja nicht mehr. Brenne nur noch. Früher. Das meint Heidelberg, als wir uns kennengelernt haben. Ich erinnere mich, wir nahmen beide den selben Bus. Ich saß hinten. Er stand am Fenster in der Mitte. Schaute mich länger an, lächelte. Ich hingegen, ich war aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr erinnere, bräsig, schaute böse zurück. Dumme Nuss! Aber zum Glück gab das Schicksal mir eine zweite Chance. Denn kurze Zeit später stellte sich heraus, wir besuchten die gleiche Gastvorlesung. Und so sprach er mich noch einmal an, als wir im Anschluss mit anderen noch eine qualmten. Andere. Das meint eine kleine Gruppe, die wir später den harten Kern nannten. Sonstige habe ich vergessen. Was wohl sehr daran liegen mag, wie ich mein Studium verfolgt habe. Heidelberg. Das erinnert mich an diese Freundschaft, die eine tiefe ist. An lange Tage und Nächte mit Schwarzertd. Verbrachte Zeit: nicht selten bis in den morgendlichen Duft der Bäckerstuben hinein.
Und so waren wir heute für ein paar Stunden zu dritt.
Die Ohrmilch der Insulanerin OLYMPIA
Ich liebe den Sound dieser Schreibmaschine und bemerke, wie sehr ich ihn doch vermisst habe. Ihre Ohrmilch. Seit Monaten höre ich sie wieder. OLYMPIA. Die auf deinen Schreibtisch, auf ihre Insel zurückgekehrte. Diese ausladende, schwere Trutzin, die sich, von allen, die du versucht hast, durchgesetzt hat. Sie wirkt auf mich wie ein Weib vom alten Schlag: pünktlich, zuverlässig, keine Spinnereien im Kopf, robust und loyal. Sie ist die Richtige! (Denke ich allein an die riesige SANDSTEINBURG. Dein Werk, an dem du schon seit 12 Jahren arbeitest. Von dem übgrigens auch nicht wenige Fassungen existieren.) Würde ich sie unter vielen heraushören können? Vielleicht. (Ich selbst bin ja nun im Besitz der legendären Olivetti Lettera 22, die ihren Grund und Boden auf meinem alten Herrenschreibtisch finden wird, mit der ich mich erst bekanntmachen muss.) Ihr Klang löst Erinnerungen in einer Stärke bei mir aus, wie ich es sonst nur durch Düfte erlebe, die einen weit, w e i t in die Zeit zurückheben können. Es war mir als wäre ich da. Als wäre ich wieder in jener Zeit, in der du viel auf ihr geschrieben hast, in der ich diesen geschäftigen und heimeligen Klang als einen täglichen, schnell vertraut werdenden, mich umgebenden erfuhr. Und so ließ sie heute Morgen sogar Gerüche wieder erstehen. Es war mir wie eine Millisekundenerzählung von einem naseweisen Wesen im Bouquet sprießender Hände, dem, ich will es verkünden, im üppigen Odeur der Blume ein obszöner Rüssel wächst. Zeitreisen ohne Strecke. Das Einfluten vergangener Empfindungen, die vom Rand der Blüte strömen, in der es reist. Bedingt durch diesen Klang! Die Ohren trompeten vor Freude. Der Mund spitzt Stücke, flötet den Wind auf. Die Arme tirilieren, domptieren den Tag. Lieder fließen von den Lippen des glückseligen Passagiers, der ich bin und soeben war in diesen Initialsekunden, die die Luken meiner Sinne anhoben, aus denen Bilder flogen, sich gefiedrig wieder unter die Zweige der Zeit zu legen. Pulsend, atmend und dauernd. (Warum ich den Sinn des Hörens offenbar mit dem Olfaktorischen verbinde, ist mir in diesem Kontext völlig erklärbar.)
Epitaph für Leon

Leon war, als wir noch in der Schweiz lebten (genau genommen hat er die eidgenössische Staatsbürgerschaft nie abgelegt), der erste Kritiker meiner Gedichte. Denn wer sonst wäre in Frage gekommen, sich einen ernsthaften Eindruck über meinen Geisteszustand zu verschaffen? Leon durchstreifte mit mir die Nächte in Lichtensteig (als ich an Die Gilde der pechschwarzen Liebe arbeitete, gingen wir jede Nacht um drei Uhr über die Thur zum Automaten, um Skumkantarell zu besorgen) und später in Winterthur, wo wir der Einsamkeit einer Stadt lauschten. Leon hat das nicht weiter gestört, Hauptsache wir waren unterwegs.
Leon hat die letzten Jahre dort verbracht, wo er wohl seine beste Zeit hatte. In Biesen, dort wo wir früher im Studio arbeiteten, wo das Ouroboros Straum, Timber, und Der Regenschirm entstand. Und wo er schließlich zu Hause war. Zum Schluss war er ein alter Mann, aber ich glaube, er war glücklich. Das Problem ist, dass mich seine Heimkehr seltsam hart trifft. Ich werde tiefer in die Nacht fliehen.
Im Busen die Blumen schwellen
Besagtes Wassermalheur in der Küche, das aus einem Zulaufhahn, dem ein Verschlussventil fehlte, als Fontäne nach oben schoss, und als Regen dann niederfiel, den ich an diesem brüllend heißen Tag unerwartet empfing, als die Maklerin im Bad den Haupthahn aufdrehte, war leider noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich sah: Gilbe Türklinken und Fensterrahmen, schnodrig geweißelte Wände, eine Tür, deren Zähne die Bodenfliesen aufreißen, eine unpraktischen Verteilung der Steckdosen. Ich sah mein Gesicht wegrutschen, äußerte: Ich bin geschockt. Das war sie auch. Ständig fiel ihr der Stift herunter. Sie beschwerte sich stante pede beim Hausmeister, der auch gleich kam. Entschuldigte sich mehrfach, hielt im Protokoll fest: der speiende Hahn solle bis morgen repariert sein, und versprach mir eine Wiedergutmachung.
Nuja. Das Bad ist immer noch ansehnlich. Recht groß, mit Badewanne und Waschmaschinenplatz. Der Blick in die Berge nicht zu verachten. Und es ist ruhig. Wirklich sonderbar aber war für mich, dass die Räume, die ich vom Besichtigungstermin mitgenommen habe, irgendwie andere waren. Sie waren mir geräumig, wurden mir im Laufe der Zeit gar weit und weiter. Ich habe sogar aus dem kleinsten Raum – ein Abstellkämmerchen – vor meinem inneren Auge, einen Tanzsaal gemacht. Das gelang mir schon einmal, vor vielen vielen Jahren, in Bergen op Zoom, als ich potselig in meinem Zelt lag, das sich dermaßen ausweitete als hätte es einen ganzen Hofstaat fassen wollen. An Phantasie mangelt es mir offenbar nicht. Nicht verwunderlich, ich vertrage ja auch keine Drogen, bin stets in anderen Sphären. Wer mit mir längere Zeit verbringt, nimmt das wahr. So ist die Entscheidung gefallen, dass der Venusberg eine Herberge meiner alten Möbelstücke wird, die ohnehin sehr raumeinnehmend sind. Ein schwerer weitflächiger Altherrenschreibstisch mit einer Schublade und jeweils einer Tür in den zwei stämmigen Beinen gehört dazu, ebenso ein alter Sessel, als auch mein bestes Stück: ein alter Jugendstilschrank mit ovalem Spiegel, Verzierungen und bunten Glaseinlassungen. Ein Schrank, der einen einlädt, ihn zu atmen, ihn zu begehen. Das wird nun unser gemeinsamer, in dem unsere Garderobe ihr Unwesen treiben kann: wenn im Busen der Kleider die Blumen schwellen …

Daher kommt er zu uns in den Keselground, in dem wir leiben und leben, wie es wohl kaum jemand anderem aufgrund der Quadratmeterzahl möglich ist. Allein die vielen Pflanzen und ihre Lust üppig zu werden, bezeugen es. Es wirkt auf uns, als fühlten sie sich äußerst wohl, sie kokettieren gar mit ihrer Erscheinung, der sie sich bewusst sind, da sie spüren, dass wir sie wahrnehmen. Fräulein Flamingo Anthurie, noch im zarten Pubertätsalter macht es vor, reckt und streckt sich, gibt alles, was wir ihr geben: in ihren grazilen Wuchs, vor allem aber in ihre wächsernen, knatschroten Phallusblüten. Ihre Babys interessieren sie nicht, sie will einfach nur obszön sein: Schminke! Schminke! Kajal und Lippenstift, ist offenbar ihr einziger Begehr.
Dennoch werden wir den Venusberg gemütlich herrichten. Meine zwei Teppiche werden es leisten. Denn es wird auch Besuch kommen, dem wir somit eigene vier Wände anbieten können. Ansonsten werde ich ihn wohl, habe ich irgendwann mal wieder mehr Zeit, als kleines Künstleratelier nutzen, in dem ich mich am Boden ausbreiten kann, um wieder zu malen. Mit vollem Körpereinsatz, mit Spatel und Spachtel, mit meinen Händen. Das war mir lange nicht möglich.
Wir beide investieren viel Energie. Betreiben Aufwand in allen Bereichen, unsere täglichen Tagespensi sind alles andere als plätschernde. Es ist mir oft, als müssten wir zum Fluss gehen, um uns Wasser zu holen. In den Wald, zum Holzhacken, um es warm zu haben. Das ist natürlich eine Übersetzung. Aber die verwendete Kraft ist oft dieselbe. Wir schleppen, wir laufen, laufen und laufen, zimmern und werkeln. Vergessen dies und das, irren, rennen ineinander, stehen staunend im Bauern herum. Bis einer von uns beiden müde unter der Achsel des Anderen einschläft.
Du bist mein Ort, schriebst du mir, … liest gerade unsere Briefe, gehst durch deinen Zettelkasten.
Deine Chimären sind seit heute nun endlich vollständig ausgedruckt. Es wird Zeit, dass ich wieder über dein Werk schreibe, ich trage es mit mir herum, seit ich damit begonnen habe.