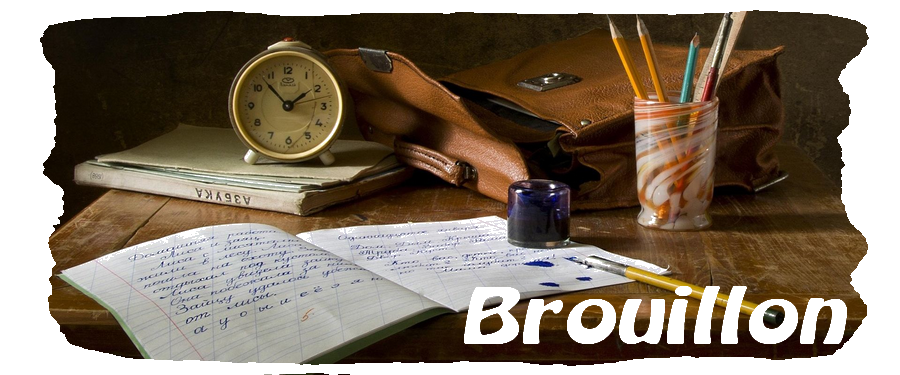Borges lobte an der Detektivgeschichte dass sie „in einer Epoche der Unordnung eine gewisse Ordnung aufrechterhalten kann“. Dieser Gedanke wird im Handbuch für Detektive von Jedediah Berry spielerisch und surrealistisch umgesetzt. Berry ist bei uns ein Unbekannter, in Amerika kennt man ihn als stellvertretenden Redakteur eines kleinen Verlags, der sich mit Phantastik sehr gut auskennt.
Seine Kurzgeschichten fanden nicht selten den stürmischen Beifall der Kritiker. Das Handbuch allerdings ist sein Debüt. 2009 geschrieben, erschien es erstaunlicher Weise 2010 bereits bei uns. In diesem Roman ist die Detektivarbeit mehr als ein Job, sie verkörpert einen geordneten Zugang zum Leben. Rätsel müssen gelöst werden, um Wahrheit und Illusion voneinander zu trennen. Sogar die Verbrecher scheinen sich hauptsächlich für das Verbrechen als Mission, als Kunstform, als Mittel zur Beeinflussung der Welt zu interessieren. Ihre Anführer sind Magier, Meister der Verkleidung, Illusionisten. Der Konflikt zwischen Detektiven und Kriminellen ist ein Aufeinanderprallen philosophischer Positionen, ein metaphysischer Kampf um die Vorherrschaft.
Unser Held ist Charles Unwin, freundlicher Aktenschreiber von Detective Travis Sivart. Er arbeitet bei der Agentur, einem Monolith der Seriosität, der seine Stadt schützt, indem er fest gegen das kriminelle Element steht. Unwin ist ein sanfter, bescheidener Kerl und nie ohne Regenschirm (es regnet immer in der Stadt). Er zeichnet sich vor allem durch die Organisation und Katalogisierung von Akten aus, die er in seiner Funktion komfortabel und zufriedenstellend erledigt. Aber als Detective Sivart verschwindet, wird Unwin unerwartet zum Detektiv befördert und als Agent ins Feld geworfen. Da er völlig ungeeignet für den Job ist, protestiert er gegen seine Beförderung, aber als er wegen Mordes verdächtigt wird, muss er den Hinweisen folgen, um herauszufinden, was vor sich geht. Als er widerwillig anfängt, Fragen zu stellen, stellt er fest, dass viele Fakten in Detective Sivarts Akten falsch dargestellt sind. Bald taucht er aus seinem Schlummer auf und versinkt in Rätseln. In der sich verdichtenden Handlung findet er Beweise, die sich nicht nur auf den vorliegenden Fall beziehen, sondern auch auf Geheimnisse, die alles untergraben könnten, was er für wahr hält.
Unwins anfänglicher Ansatz bei seinen Ermittlungen ist der eines Sekretärs: Er versucht mechanisch, das zu tun, was er denkt, was von ihm erwartet wird, sortiert die Fakten und blufft sich durch eine Reihe merkwürdiger Entdeckungen. Seine Verwandlung in einen Agenten beginnt, als er ein Exemplar des Handbuchs für Detektive – die Bibel der Agentur über Theorie und Praxis der Detektivarbeit – öffnet und seinen ersten Ratschlag liest (unter der Überschrift „Kriminalfall, Erste Schritte“):
Der unerfahrene Agent, der auf ein paar erste vielversprechende Spuren stößt, wird wahrscheinlich den Drang verspüren, ihnen so direkt zu folgen wie möglich. Doch ein Kriminalfall ist wie ein dunkles Zimmer, in dem ihn alles erwarten könnte. In diesem Stadium des Falles wissen Ihre Gegner mehr als Sie – genau das macht sie erst zu ihren Gegnern. Deshalb ist es von höchster Bedeutung, dass Sie mit Vorsicht und Raffinesse vorgehen, besonders zu Beginn Ihrer Arbeit. Jede andere Vorgehensweise wäre gleichbedeutend mit einer Kapitulation; dann könnten Sie auch gleich Ihre Taschen ausleeren, eine Lampe über Ihrem Kopf anschalten und sich eine große Zielscheibe auf die Brust malen.
Auch für die Leser dieses Romans ist es ein guter Ratschlag, anders vorzugehen. Die Erzählung treibt uns nicht vorwärts, der Eroberung entgegen, sondern zieht uns langsam tiefer in eine geheimnisvolle Welt. Die Grenzen zwischen Realismus und Traumbildern sind verschwommen. Die Zeit, in der die Ereignisse stattfinden, wird nie genau festgelegt, obwohl die Geschichte durchweg eine vage Atmosphäre des frühen zwanzigsten Jahrhunderts aufrechterhält. Und doch fühlt sich das Buch frisch und modern, ja sogar experimentell an. Es ist ein Roman, der Vergleiche mit anderen Romanen provoziert, weil es so schwierig ist, ohne einen einzigen Bezugspunkt auszukommen, was aber auch einfach daran liegt, dass das Handbuch für Detektive eine einzigartige Schöpfung ist, die selbstbewusst in ihrer Genre-synthetisierenden Originalität konstruiert wurde.
Trotz dieser interessanten Eigenschaften muss man sich an die Erzählweise erst einmal gewöhnen. Die Handlung wird schnell unüberschaubar und halluzinatorisch, so dass es alles andere als leicht ist, ihr zu folgen. Die manierierte, schwach altertümelnde Prosa erscheint zunächst übermäßig raffiniert; Leichen türmen sich auf, und doch fühlt sich ein großer Teil der Handlung seltsam blutleer an, dem Traum näher als einer greifbaren Form.
Im Jahr 1924 schrieb André Breton im ersten Manifest des Surrealismus von seinem Versuch, das Bewusstsein zu erweitern und eine Überrealität zu finden, indem er die Assoziationsmöglichkeiten des unbewussten Geistes erforschte.
In Berrys Roman wird ein ähnlicher Begriff zu praktischen Zwecken von Detektiven der Agentur verwendet, indem sie in der Lage sind, verdächtige Personen in ihren Träumen auszuspionieren und dadurch Hinweise zu entdecken, die das Unbewusste über ihre Verbrechen preisgeben kann. Während Unwin diese Überwachungsmethode benutzt, um Hinweisen zu folgen, driftet die Geschichte mehr und mehr ins Surreale ab. Merkwürdigerweise taucht Unwin immer mehr in die Traumwelt ein und wird dadurch lebendiger und wacher als jemals zuvor in seinem Leben. Als wir ihm zum ersten Mal begegnen ist Unwin weit vom Modell eines hartgesottenen Detektivs entfernt, ist sanftmütig und bescheiden, so zugeknöpft und vorsichtig, dass es schwierig ist, ihn zu fassen. Während er sich jedoch bemüht, seine Gegner zu verstehen, beginnt er damit, seine eigenen Instinkte zu entwickeln. Von diesem Augenblick an fließt Leben in die Geschichte ein.
In ähnlicher Weise wird die Überlagerung von präziser, schicker Prosa in einem bizarren Kontext hypnotisch. Die Präzision von Unwins Perspektive verleiht jeder Szene einen Realismus, der ständig untergraben wird. Die Geschichte geht nie in bloße Merkwürdigkeiten über, sondern bleibt in der unerbittlichen Traumlogik ihrer Welt verankert. Sie erreicht und verunsichert den Leser auf unbewusster Ebene. Science-Fiction-Fans sprechen gerne über den „Sense of Wonder“, der sich aus der Begegnung mit neuen Konzepten und Kreationen ergibt, hier aber wird das heikle Gefühl dargestellt, das entsteht, wenn etwas Vertrautes völlig fremd erscheint: ein Gefühl des Mysteriums. Nehmen wir zum Beispiel diese Szene, als Unwin bemerkt, dass man ihn ausspioniert:
„Er versucht sich zu konzentrieren“, sagte der Mann am Telefon.
Unwin legte das Handbuch weg und erhob sich von seinem Stuhl. Er hatte sich nicht verhört. Der Mann mit dem blonden Bart sprach Unwins Gedanken laut aus. Seine Hände zitterten bei dem Gedanken; er hatte angefangen zu schwitzen. Die Männer am Tresen fuhren erneut herum und sahen dabei zu, wie Unwin in den hinteren Teil des Raumes ging und dem Mann auf die Schuter tippte.
Der Mann mit dem blonden Spitzbart blickte auf. In seinen hervorquellenden Augen war zu lesen, dass er zu Handgreiflichkeiten bereit war. „Such dir ein anderes Telefon“, zischte er. „Ich war zuerst hier.“
„Haben Sie gerade über mich geredet?“, fragte Unwin.
Der Mann sagte in den Hörer: „Er will wissen, ob ich gerade über ihn geredet habe.“ Er lauschte, nickte, nickte noch einmal und sagte dann zu Unwin: „Nein, ich habe nicht über Sie geredet.“
Unwin wurde von einer schrecklichen Panik ergriffen.
Kurz gesagt, Berry hat einen Roman mit der sinnlich herausfordernden Wirkung eines Magritte-Gemäldes zusammengestellt, und jedes Element der Geschichte arbeitet zusammen, um diesen Effekt zu erzeugen. Es ist Unwins empfängliche, ungeformte Eigenschaft, die es ihm erlaubt, die Landschaft als eine Art luzider Träumer zu durchqueren und Informationen vorurteilsfrei so zu sichten, wie sie ihm zufliegen, ohne sich zu sehr in dem zu verzetteln, was er weiß, und vielleicht fälschlicherweise für wahr hält. Er setzt seinen klaren, methodischen Ansatz fort, auch wenn die Realität um ihn herum dekonstruiert wird. Damit ist es folgerichtig, dass die Geschichte in dem Tempo voranschreitet, in dem sie das tut, denn es liegt in der Natur dieses Buches, dass es den Leser nicht mit Gefühlen, Aktionen oder schillernden Bildern bombardiert. Hier ist das Geschichtenerzählen das Gegenteil von Bombast, es lädt in eine stilvolle Welt ein, und es gibt hier nur spärlich Hinweise. Es ist eher ein stimmungsvolles Buch, in dessen Atmosphäre man versinken und sich fortspülen lassen kann. Und es dringt in das Gemüt.
Das Handbuch für Detektive ist glänzende surreale Kunst und zweifellos auch ein gutes Stück altmodischer Detektiverzählung, wo alles miteinander verbunden ist und dem Leser die Befriedigung eines zu entziffernden Rätsels geboten wird, in dem ineinander greifende Teile zu einem logischen Ganzen zusammengefügt werden. Doch etwas Größeres verweilt hinter den einzelnen Rätseln, die Unwin erforscht: Ein Mysterium, fremd und unbekannt.
Unwin wird an einer Stelle als „akribischer Träumer“ beschrieben, und dieses elegante, komplizierte, ehrgeizige Buch hinterlässt das Gefühl, dass es eine wunderbare Sache ist, ein akribischer Träumer zu sein.