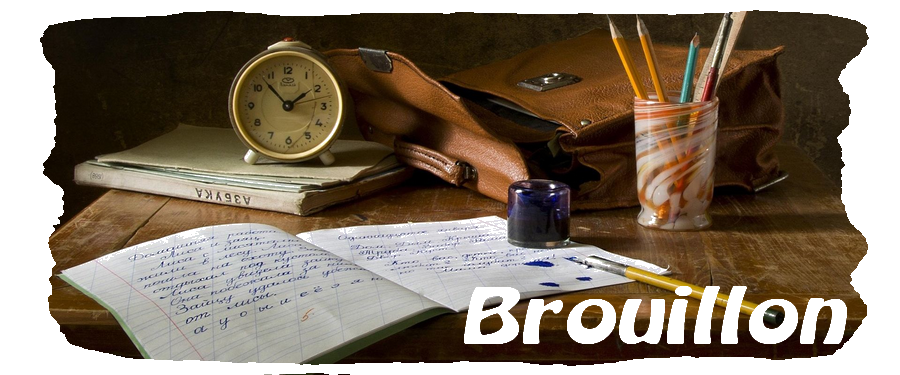In vielen Textformen spüre ich nach der Essenz des Andockens. Man spricht so oft von dem, was zwischen den Zeilen steht, nur steht da nichts (ich habe nachgeschaut). Der wahre Autor weiss nicht, was er tut und kann deshalb auch nichts zwischen die Zeilen schreiben. Völlig absichtslos aber widerfahren ihm andockbare Ziele.
Brouillon
der BROUILLON ist tagesgeschäft, nicht mehr als journaling über unwichtige persönliche befindlichkeiten.
Schattentod
Was ich sagen will ist, dass Lyrik nicht gedacht werden kann – allenthalben die Formalisten taten sich daran gütlich, hatten aber zumindest mit ihrer Kritik Recht, die sich auf die Leugnung musikalischer Muster in Gedichten stützte; denn was lautet, ist grundsätzlich der Musik zuzurechnen, ob es den Vertretern der Musik oder den Vertretern der Poeterei nun passt oder nicht. Doch auch hier gilt das, was ich allenthalben für Europa sagen kann: dass die Verquickung aller Schulen ein Gespräch ergibt, dass der Bezug auf die eigene präferierte Leistung lahm erscheint, unergiebig; ein Schattentod, der die grellen Lichter das Objekt verunstalten lässt. Und damit will ich gar nicht an einer Verunstaltung rütteln, die eben gerade neu zu gestalten vermag. Mit neuen Erfahrungen das einst Aufgegebene noch einmal besehen, das Zeitlose daran filtern (und das meint immer das Rätsel unserer Existenz; es meint ausschließlich das Rätsel unserer Existenz) – das scheint mir jegliche Verunstaltung zu rechtfertigen. Ich könnte jetzt hinzufügen: Um zum Kern zu gelangen, aber es dürfte sich herumgesprochen haben, dass es keinen Kern gibt, dass wir in Feldern zu denken haben. Lyrik – hat man einst behauptet – umkreist seinen Gegenstand, aber in Wirklichkeit wird da gar nichts umkreist, weil das Gedicht schon der Gegenstand ist, und sei es ein Loch, das alles in sein Gegenteil verkehrt.
Subversion
Ob das alles Öffentlichkeit braucht, weiß ich nicht, ich kann ganz gut für mich sein. Aber tatsächlich beschäftige ich mich mit dem Nachher meiner Arbeit, was konkret bedeutet, dass ich jetzt, wo ich dem Ende von GrammaTau zuneige (und auch die Sandsteinburg ausgeschrieben habe), konsequenterweise verstummen müsste oder eine neue Tür finden, die für mich gangbar ist. Natürlich weigere ich mich bis an mein Lebensende, verständlich zu sein, weil ich Verständlichkeit für Opportunismus halte, zumindest, was die Kunst betrifft (der Rest war mir jederzeit und alle Zeit vollkommen egal). Die Welt ist dann ein Kunstwerk, wenn sie unterschiedlich interpretiert werden kann. Da niemand die Welt versteht, ist das der Fall. In meiner Zurückgezogenheit gelingt es mir, subversiv zu sein, die Referenz meiner Arbeit bin nunmehr nur ich selbst. Es drängen sich Urlaute auf, Fragmente, die mit Lauten zu einem Rhythmus verbunden werden, der länger in der Luft schweben kann als ein Takt, als Nachbild, als Nach-Sonne. In meinen Gedichten kann es nicht mehr um die fremdartige Anwendung und Zusammensetzung von Sprache allein gehen; der Schwerpunkt könnte die Prosodie bilden, die ich bisher immer nur bis zu einem gewissen Grad berücksichtigt habe (wenn auch schon stark genug, um sie als Relevant zu bezeichnen). Da habe ich noch Forschungsgrund.
Baunacht
Also kramte ich, weil ich wieder nicht schlafen konnte, den Apparat unter der Kommode hervor, den Staub wischte ich erst gestern von seiner Oberfläche, diese Patina der ruchlosen Umgebung hatte mir lange lange gefallen. Gestern störte sie mich. Die Nacht bietet der Stimme einen anderen Raum; das liegt nicht allein an der Stille, es liegt vielmehr an der Schwingung aller Gegenstände In den letzten Tagen bemerke ich sehr genau, wie die einzelnen Stücke der Sandsteinburg nie exakt mit einer einzigen Einstellung bearbeitet werden können. Bei GrammaTau ist das selbstverständlich der unterschiedlichen Interpretation geschuldet, die Sandsteinburg ist aber – zumindest in seinen längeren Ezählpassagen – als Einheit zu verstehen. Von Kapitel 3 : Es gab einen Sturm, habe ich die gewünschten 8 Teile, um beginnen zu können, nun fertig. Doch es trifft sich sehr gut, dass ich auch – eben in besagter letzter Nacht – noch weitere Gedichte „bespielt“ habe. Seit ich in der Schweiz „Die Gilde“ zusammenstellte, habe ich das nicht mehr in die Nacht gelegt. Nachts sind hier arabische Familien unterwegs, sie laufen mitten auf der dunklen Straße und grölen wie Ballermann-Jünger. Das tun sie aber nicht, weil sie die gleiche Gehirnschmelze aufweisen, sondern weil sie es so gewohnt sind. Vielleicht nehmen sie Tag und Nacht in ihrer Unterscheidung nicht wahr. Oder es ist ihnen schlicht egal. Wenn ich die Balkontüre schließe, ersticke ich nach etwa einer Viertelstunde, aber sie hält doch einen Großteil Lärm ab. Tagsüber, wenn gegenüber das „Höllenhaus“ entkernt wird, sieht die Sache anders aus, da muss ich dann die Musik in die Höhe treiben, um etwas anderes zu hören als das Treiben der Wanderarbeier aus dem Osten. Das mag sich alles nach einem grundgütigen Ghetto anhören, dabei verwandelt sich das Viertel um die alte Spinnerei doch in eine sanierte Prinzessin – so zumindest der Schein. Seit ich hier wohne, zeigt die Baubehörde, was sie so unter Leben versteht.
Hochdruckreiniger
Zuerst turnte der Mann in einem gelben Regenmantel mit einem Hochdruckreiniger über das Geländer des Balkons, um das Haus in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Wir zogen die schweren Vorhänge zu und das Geräusch, als führen wir in eine Autowaschanlage, war aushaltbar. Als wir so schön im schummrigen Dunkel saßen und Herbie Hancock hörten, brach plötzlich die Stromversorgung zusammen. Bis jetzt lässt sich der Hauptschalter auch nicht wieder nach oben arretieren. So musste ich sämtliche Dreifachsteckdosen zusammenstecken, um von der Steckdose im Flur Saft zu bekommen, denn Flur und Bad sind nicht betroffen. Selbstverständlich bekommen wir den zuständigen Elektriker am Freitag nicht mehr an die Muschel. Um später auch noch die Anlage und die Stehlampe zu versorgen, muss ich wohl auf die Schnelle eine Kabeltrommel organisieren. Es wird die Zeit kommen, da werden wir hier auf dem Boden ein Feuerchen machen müssen. Zumindest der Wasserkocher steht dort schon mal.
Fangfrischer Meerrettich
Diesmal konnte ich mir für eine Reduktion zwei Tage Zeit nehmen. Freitags kochte ich stundenlang das Wurzelgemüse, Knochen und Fleisch I aus. Daraus wurde die samstägliche Gemüsesuppe. Mit der Hälfte der Reduktion kochte ich noch einmal ein neues Stück Fleisch aus. Daraus wurde am Sonntag das Kren. Leider hatte ich keinen fangfrischen Meerrettich. Diese Tiere sind sehr scheu und man erwischt sie meist nur, wenn man tagelang unter der Erde spazieren geht. Das tat der mörderischen Geschmacksästhetik jedoch keinen Abbruch. Für mich ist die deutsch-böhmisch-österreichische Küche die beste der Welt, dicht gefolgt von der mexikanischen, die allerdings oft an den Zutaten scheitert, obwohl ich hier zumindest schwarze Bohnen bekomme.
Königsberger Klopse
Das untergegangene Preußen hat sich viele seiner Begrifflichkeiten aus der französischen Mode abgeschaut. Eines dieser französischen Wörter, nämlich escalope wurde zum Klops, gemeint ist damit natürlich ein Fleischbällchen. Die berühmten Königsberger Klopse gibt es in vielen Varianten, man kann aber davon ausgehen, dass die Ostpreußen in der Hauptsache Hering unter das Rinderhack mischten, während es bei Hofe unbedingt Sardellen sein mussten. Der Siegeszug dieses eigentümlichen Gerichts verlor mancherorts den Fischanteil ganz, was aber essentiell blieb, waren Estragon, Senf und natürlich Kapern. Laut der Legende wurde Fisch dem Hack nur dann beigemischt, wenn die damals teuren und luxuriösen Kapern nicht bei der Hand waren. Vergessen werden darf allerdings nicht, dass es das Hack, wie wir es heute kennen, erst seit 1850 gibt, da vorher kein Fleischwolf zur Hand war. Will man historisch zu Werke gehen, muss das Fleisch (in der ersten Stunde dieses Gerichts handelte es sich um Kalb) zunächst mürbe geschlagen und dann geschabt werden. Die französischstämmige Kapernsorte Nonpareilles dürfte dabei als das Nonplusultra gelten, und es versteht sich von selbst, dass es dann auch Dijon-Senf sein muss. Weißwein, Butter, Sahne, ein Hauch von Muskat und Zitronenschalenstaub runden das Bild dieses Klassikers ab.
Nur Beute
Am Anfang war nichts, nur Beute. Aber eine Welt musste her.
Die Welt besteht nicht so sehr aus dem Zusammenspiel zwischen Molekülen und Geist, sondern aus Sprache. Und daran erkennt man so einiges.
Ich bin jetzt hier. (Und die Frage geht: War ich je woanders?). Ich bin durch Räume geschritten und nicht durch die Zeit. In einer Epoche zu leben bedeutet, in einer anderen Epoche nicht zu leben; die Wahl fällt hinterher, die Aussage, ob man das wollte. Wenn man sich für ein Irritativ entscheidet, lebt man eine Epoche in einer anderen. Das wird schwer, vor allem mit dem Kleidern, aber auch mit der Sprache oder dem Gestus. Oder dem Essen. Aber vor allem mit den Kleidern, die nur noch die Fassade leisten können, ein oberflächliches Zelt, hinter dem sich kein Kacksand befindet, kein Dunggeruch der Heimeligkeit, sondern der harsche Zeitwandel einer eklatanten Nichtskönnerei.
Gespräch über die Kunst (mit Albera), die sich selbst genügt, die nur aus sich heraus und für sich ist, ausgehend von der Frage nach dem Sinn; ein interessanter Bogen, der zum Existentialismus führt.
Gewohnheit
Es war nie wichtiger, seine Lesegewohnheiten zu ändern, als dies heute der Fall ist. Zwar hat die Höhenkammliteratur nie etwas anderes getan, als die Form und das Verhältnis zur Sprache in abstraktes Terrain zu führen, die Erzählverweigerung aber, die daraus resultierte, brachte kein wirklich gutes Ergebnis. Es sollte darum gehen, Erzählformen zu finden, die mit dem Überkommenen brechen, die aber niemals das Erzählenmüssen der Menschheit torpetieren. So kann eine Geschichte, die nirgends hinführt, das Scheitern einer Lebensprognose viel besser aufzeigen als die plakative Verweigerung. Ein Text kann nicht abgeschlossen sein, so etwas ist unmöglich. Aber wenn er existiert, hat er etwas zu erzählen, und wenn es seine Entstehung ist.
Tarock der Läufer und Fänger
Im Titel stehts bereits, was ich sagen will. Aber das ist natürlich ne faule Aussage von mir. Das weiß ich. Ich bin weltfaul und der meisten meiner Artgenossen überdrüssig. Das wiederum lässt tief blicken. Stille psychoanalytische Fischrachenanalyse.

Ich entwerfe gerade ein Tarock für das, was bisher noch „Sandsteinburg“ heißt und irgendwo in Schubladen, unter Schränken und in meinem Schädel umherfledert. Genommen werden Figuren, Symbole und Szenen aus ihr. Das bedeutet zwangsläufig: Ich muss auch eine eigene Legende zu den Karten entwerfen. Ein absolut sinnloses Unterfangen, zu dem die Hochlebe-Luftpuppe der Kunst eine ihrer blonden Strähnen zwischen zwei ihrer Finger zwirbelt, um sie zwischen Nase und Oberlippe zu klemmen, sobald sie schweinsnaserümpfend ein Fischmaul mimt. Zimpel commonzenzes.