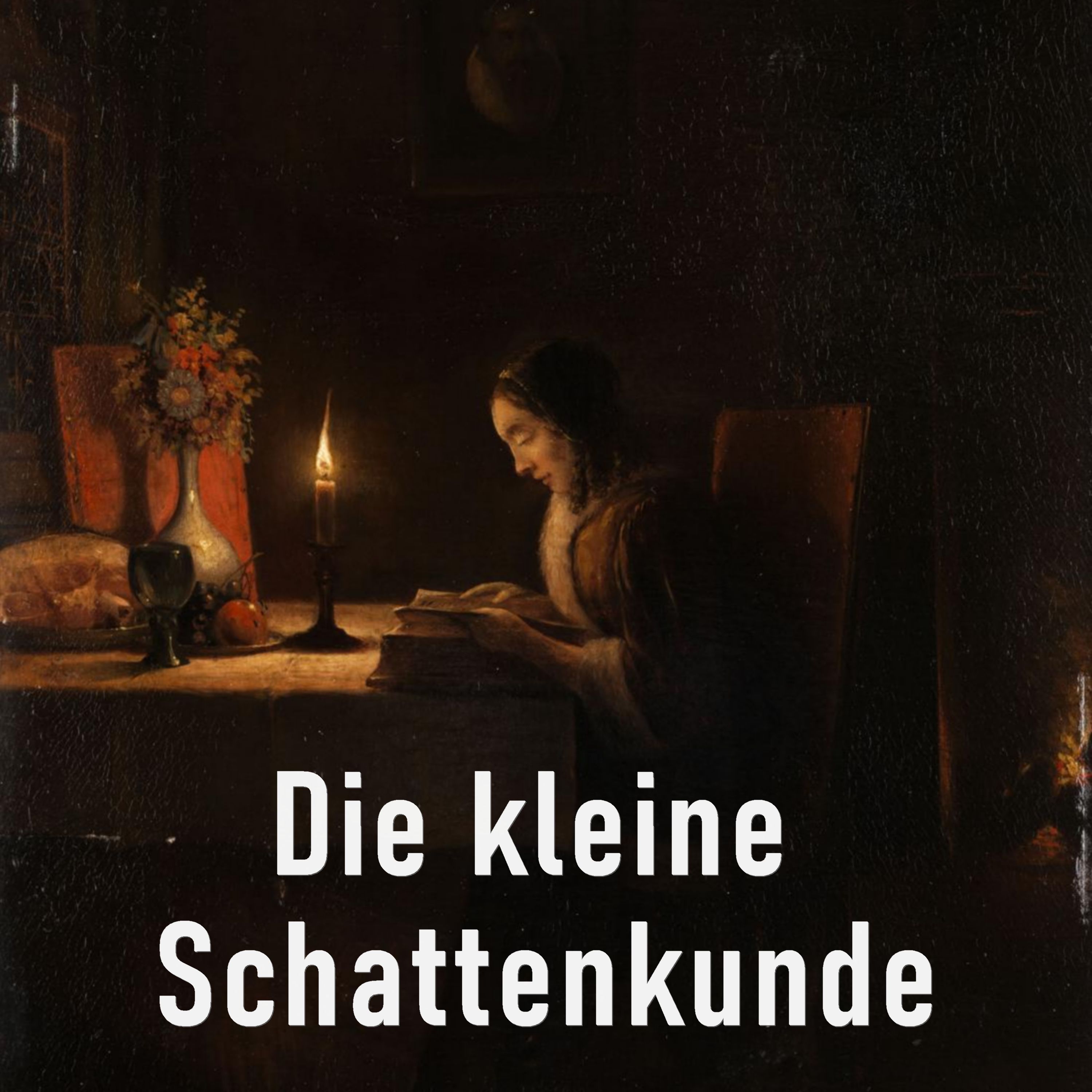
Die kleine Schattenkunde ist ein literarischer Werkstatt-Podcast. Jede Folge führt zu einem anderen Text: Skizzen, Fragmente, seltsame Beobachtungen und fertig gelesene Passagen. Nur der Prozess des Erzählens und die Geschichten, die an den Rändern des Gewöhnlichen entstehen. Für alle, die das Unbestimmte lieben.
Dem Tod so nah ist kein Pageturner im klassischen Sinne, sondern ein Noir-Horror über das Sehen: über den Blick, das Bild, das Begehren – und den ethischen Preis der Kunst. Der Roman besticht durch eine kompromisslos ehrliche, oft abstoßend faszinierende Ich-Erzählerin, eine messerscharfe Prosa und ein Setting aus Wetter, Holz, Salz und Schatten. Hand verhandelt die Frage, was Bilder mit der Wirklichkeit anstellen – und mit den Menschen, die sie machen.
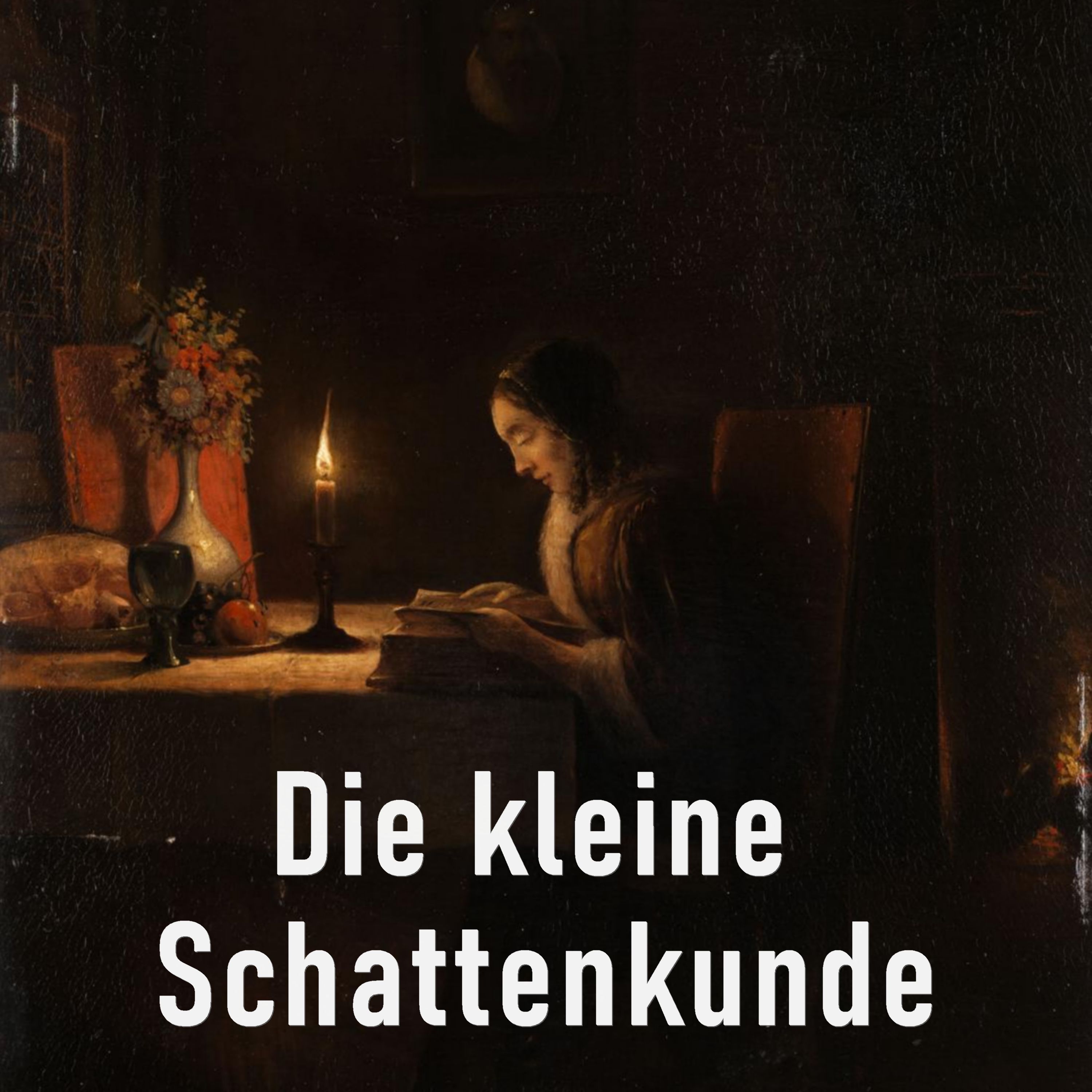
Dem Tod so nah ist kein Pageturner im klassischen Sinne, sondern ein Noir-Horror über das Sehen: über den Blick, das Bild, das Begehren – und den ethischen Preis der Kunst. Der Roman besticht durch eine kompromisslos ehrliche, oft abstoßend faszinierende Ich-Erzählerin, eine messerscharfe Prosa und ein Setting aus Wetter, Holz, Salz und Schatten. Hand verhandelt die Frage, was Bilder mit der Wirklichkeit anstellen – und mit den Menschen, die sie machen.

Cass Neary, einst ein Shooting-Star der New Yorker Punk-Fotografie, heute ausgebrannt, abgehalftert, und gezeichnet von zu viel Pillen und Alkohol, bekommt eine letzte Chance: sie soll eine zurückgezogen lebende Ikone der 70er-Fotokunst auf einer abgelegenen Insel vor der Küste von Maine interviewen. Was wie eine Reportage beginnt, entwickelt sich zur Erkundung einer Landschaft aus Verschwinden, Gewalt und künstlerischer Obsession. Jugendliche werden vermisst, die Dorfgemeinschaft schweigt, und je näher Cass der legendenumwobenen Kollegin kommt, desto deutlicher wird, dass nicht nur Bilder, sondern auch Menschen „entwickelt“ – und dabei zerstört – werden können.
Der Plot bedient die Struktur des Ermittlungsromans, aber Hand löst sie nach und nach in Atmosphären und Wahrnehmungsverschiebungen auf. Die eigentliche „Ermittlung“ findet im Medium des Blicks statt: Was sehe ich? Was will ich sehen? Und was blende ich aus, um weitersehen zu können?
Cass ist eine der großen Antiheldinnen des zeitgenössischen Noir: witzig und zynisch. Sie brilliert in Selbstverachtung und Selbstschutz – und ist gerade dadurch durchlässig für die Geister der Vergangenheit. Ihr Ton ist hart, knapp, präzise; er riecht nach Dunkelkammerchemie. Hand findet für Cass eine Sprache, die wie ein altes Objektiv funktioniert: minimal verzeichnet, maximal ehrlich. Das schafft Nähe, ohne um Sympathie zu werben. Wir vertrauen Cass’ Blick, gerade weil er keineswegs edel ist.
Die Nebenfiguren – Inselbewohner, Künstler, Aussteiger – wirken zunächst wie Archetypen (der wortkarge Fischer, die verbitterte Künstlerin, der zu gefällige Vermittler des Auftrags). Hand nutzt diese Typisierungen allerdings bewusst: Sie sind Masken, die den Charakter dahinter verbergen sollen. Wie in allen guten Kriminalromanen entscheidet am Ende nicht die Exotik des Personals, sondern die Ökologie der Beziehungen: Wer profitiert wovon? Wer schaut wen an – und warum?
Generation Loss als Leitmetapher
Der Begriff „Generation Loss“, der in der deutschen Übersetzung leider (wie so oft bei sprechenden Titeln) ignoriert oder vom Verlag gar nicht erst verstanden wird, bezeichnet im technischen Sinn den Qualitätsverlust bei wiederholtem Kopieren – Körnung, Rauschen, Artefakte, Verlust von Dynamik. Hand überträgt dieses Prinzip aber auf mehrere Ebenen, weshalb der Titel „Dem Tod so nah“ absoluter Blödsinn ist.
Da wäre einmal Kunst als Reproduktion. Die Punk-Fotografie der 70er, einst reine, grobe Authentizität und ein Angriff auf das Glamouröse und Etablierte, ist zum reinen Produkt verkommen – unendlich reproduzierbar, und dadurch museal, also vollkommen entschärft. Was bleibt von der ehemaligen Radikalität, wenn sie tausendmal nachgedruckt wurde?
Dann hätten wir Erinnerung und Trauma. Cass’ eigenes Leben ist eine Kette von Kopien ihres früheren Selbst. Jede einzelne davon (Drogen, ihre bitteren Nächte, ein weiterer Auftrag) verschlechtert das Original. Erinnerungen sind nichts anderes mehr als kontrastverstärkte Abzüge.Des weiteren reproduziert auch die Inselgemeinschaft ihre Erzählungen (etwa über Kunst oder Schuld), bis diese zur zweiten Natur geworden sind. Der Verlust an Nuancen führt zum Ende: Wo das Bild alles beherrscht, stirbt schließlich das Gesehene.
Hand komponiert ihre Metaphern in Motive, Räume, Handlungen hinein und das macht den Roman dichter, als sein Umfang vermuten lässt.
Schönheit am Abgrund
Hand treibt eine Frage vor sich her: Darf Kunst sich am Leid nähren? Cass’ Ruhm gründet auf Bildern, die das Hässliche und Zerbrochene mit einer verstörenden Würde versehen. Doch der Roman rückt die Kosten dieser Ästhetik ins Zentrum. In der Fotografie kommt der Blick dem Besitz gleich: Wer ablichtet, nimmt sich etwas – auch wenn er „nur“ dokumentiert. Generation Loss zwingt die Lesenden zur Komplizenschaft. Wir wollen wissen, was passiert ist – wir sehen hin – und genau dieses Hinsehen reproduziert das, was den Figuren tatsächlich geschieht.
Die Szene-Ökonomie des Textes ist hierfür zentral: Hand zeigt selten Spektakel. Sie zeigt Spuren, Ränder, Nachbilder. Wie in einer Dunkelkammer entstehen die schlimmsten Bilder indirekt: aus Schatten, Lücken, Gerüchen, Geräuschen des Meeres. Das ist nicht nur stilistische Finesse; es ist eine ethische Entscheidung, und die Leser sind mitverantwortlich.
Auch die Insel ist kein bloßes Setting, sondern eine aktive Instanz: Nebel, Kälte, morsches Holz, Salz auf Metall, das Blinken entfernter Bojen. Natur ist hier kein romantischer Gegenpol zur Stadt, sondern ein Medium – sie konserviert und zersetzt zugleich. Wie im klassischen Schauerroman trägt die Landschaft Schuld und Geschichte in sich. Jeder Steg, jedes verfallene Haus wirkt wie eine überbelichtete Stelle auf einem Negativ, an der Information bereits verbrannt ist. Das Meer fungiert als Archiv: Es spült Dinge an – und löscht Spuren.
Noir trifft Folk Horror
Formell arbeitet der Roman mit der Apparatur des Noir (Antiheldin, ein seltsamer Auftrag, Lügen, Korruption), nimmt dann aber Züge des Folk-Horror an: eine abgeschlossene Gemeinschaft, archaische Riten des Blicks (Sammeln, Ausstellen, Fixieren), Natur als Gesetzgeber. Der Übergang geschieht ohne großen Bruch – Hand verlagert schlicht die Definition von „Beweis“. Nicht mehr Fingerabdrücke zählen, sondern Bilder und Erzählungen werden hier herangezogen.
Hand braucht keine Übernatürlichkeit, um kosmische Kälte zu erzeugen; ihr genügt die Konsequenz, mit der Menschen Bilder über Menschen stellen, und deshalb schreibt sie auch photografisch: kurze Brennweiten (scharfe Details), dann wieder Weitwinkel (Landschaften), abrupte Blendenwechsel zwischen Außen und Innen. Der Rhythmus ist hart geschnitten; Dialoge sind nicht dafür da, etwas zu erklären, sondern um die Textur sozialer Reibung hörbar zu machen. Besonders stark ist, wie Hand Fachvokabular der Fotografie ohne Fetisch verwendet: ISO, Körnung, Kontrast erscheinen nicht als Recherche-Trophäen, sondern als Denkmodelle der Figur.
Bemerkenswert ist auch die Ökonomie der Metaphern. Hand überlädt nicht; wenn ein Bild auftaucht, trägt es Handlung. Ein Beispieltypus: Metall, das im Salzwasser rostet – das ist Cass, das sind die Archive, das ist die Kunst. Wiederkehrende Gegenstände (Kameras, Abzüge, Leuchtfeuer, Tierkörper) dienen als Scharnier zwischen Psychologie und Plot.
Themenfelder im Detail
1) Kunst vs. Leben
Der Roman verweigert eine romantische Künstlermythologie. Kunst ist hier nicht Rettung, sondern Risiko: eine Praxis, die Leben – eigenes wie fremdes – verbraucht. Wer „starke“ Bilder will, riskiert, den Menschen dahinter zu verlieren. Die Pointe ist nicht moralistisch, sondern tragisch: Es gibt Bilder, die es wert sind, gemacht zu werden – und doch sollte man sie nie machen.
2) Trauma & Erinnerung
Cass’ Rückblenden operieren wie beschädigte Negative. Entscheidend ist, dass die Erzählung nicht „heilt“. Statt Katharsis gibt es Funktionsgewinn: Cass lernt, mit der Beschädigung zu arbeiten, nicht sie zu tilgen. Das ist ungleich ehrlicher als gängige „Recovery“-Bögen – und literarisch überzeugender.
3) Geschlecht & Gewalt
Ohne Parolen zeigt Hand, wie weibliche Körper historisch als Bildträger missbraucht werden: Muse, Model, Opfer. Cass’ Blick konterkariert das, indem er Kontrolle zurückholt – aber nie vollständig. Der Roman erlaubt Ambivalenz: Cass ist Täterin und Zeugin, Nutznießerin und Kritikerin des Systems „Blick“.
4) Subkultur & Kommodifizierung
Punk als Geste gegen Besitzverhältnisse ist zur Ware geworden – Poster, Retrobeiträge, Auktionskataloge. Das ist der vielleicht bitterste Teil des Buchs: Rebellion ist reproduzierbar, weil sie auf Bildträgern geschieht. Die ursprüngliche Energie verkommt zum Look. Das ist der eigentliche „Generation Loss“ des Kulturkapitals.
Vom Rauschen zur Kontur
Die erste Buchhälfte tastet, sammelt Material, baut Atmosphäre auf; wer nur auf billigen Thrill aus ist, wird in sich die Ungeduld des schlechten Lesers aufkeimen spüren. Doch genau dieses Tasten ist funktional: Es simuliert die Dunkelkammer, in der sich die Konturen nur langsam herausschälen. Im letzten Drittel zieht Hand die Belichtungszeit nach oben: Die einzelnen Teile rasten ein, Motiv und Tat werden eins. Die Auflösung ist schlüssig, ohne sich als sauberer Schlussakkord auszugeben. Es werden Kratzer bleiben.
Damit steht der Roman an der Schnittstelle von literarischer Kriminalliteratur und psychologischem Horror. Wer Patricia Highsmiths moralische Kälte, Shirley Jacksons Psychologie der Räume oder die Bildethik einer Susan Sontag schätzt, findet hier einen Text, der das alles in die Gegenwart übersetzt. Innerhalb von Hands Werk markiert der Roman den Beginn einer Serie, aber er funktioniert vollständig autonom: Seine Fragen sind zu Ende gedacht, auch wenn sie notwendigerweise offen bleiben.
Elizabeth Hand hat mit Generation Loss einen seltenen Roman geschrieben: formal sicher, atmosphärisch zwingend, thematisch unbequem. Er fragt nicht, was wir sehen wollen, sondern warum – und was dadurch auf der Strecke bleibt. Wer bereit ist, sich von einer kompromisslosen Erzählerin und einer scharfkantigen Prosa die Haut leicht anritzen zu lassen, findet hier eine der prägnantesten Erkundungen der Kunst-Ethik im Genregewand der letzten Jahrzehnte.
Empfehlung: Lesen – und danach die eigenen Bilder (digital wie mental) noch einmal anschauen, als wären sie Abzüge, die schon die nächste Generation verlieren könnten. Was – ehrlich gesagt – bereits nicht mehr aufzuhalten ist.
