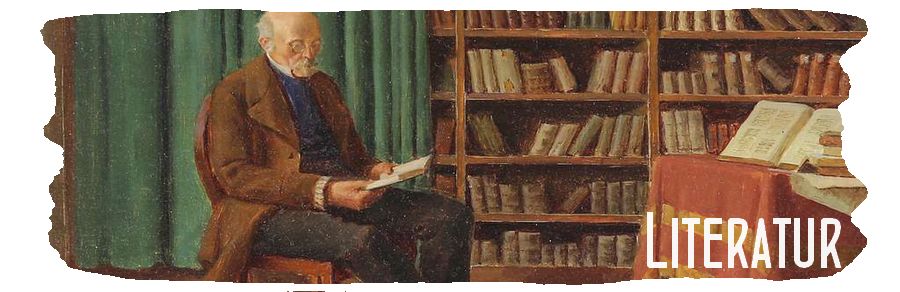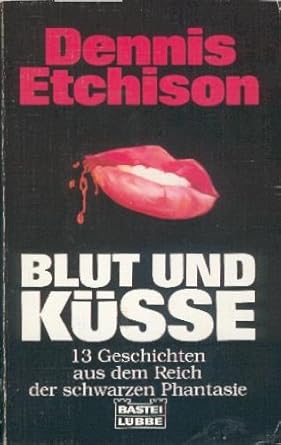Wir sollten sie kennen, die erste deutsche Horrorgeschichte, sollten verstehen, warum sie es ist, und weshalb sie viele andere Autoren und ihre Geschichten, die folgten, beeinflusste. Wir sollten wissen, was an diesem urdeutschen Horror das Eigene und Unheimliche ist, um was für ein Gespür es sich handelt, das sich im Laufe der Jahrhunderte hierzulande innerhalb der schreibenden Zunft weitestgehend verflüchtigt hat. Es ist ein Bewusstsein, das die Denk- und Arbeitsweise von C. G. Jung und Sigmund Freud wesentlich mitbestimmte, ein Bewusstsein, das wieder erwachen will, im Gedenken einer vergangenen Kultur, die ihre mystische Natur lobpreiste, die, anstelle von Verstand und Logik, das Gefühl, die Sehnsucht und die Liebe des Menschen in den Vordergrund stellte.
Bereits 1796 in „Märchen aus dem Phantasus“ zum ersten Mal veröffentlicht, erschien Der blonde Eckbert nur ein Jahr später in der von Ludwig Tieck selbst herausgegebenen Sammlung „Volksmährchen“ erneut. Wie viele der Geschichten, die bereits im „Phantasus“ erschienen waren und von ihm überarbeitet wurden. Tieck, der sich, neben dem Berliner und Heidelberger Kreis, auch dem Jenaer Kreis der Frühromantiker anschloss, agierte damals noch unter dem Pseudonym Peter Leberecht. Als Kunstmärchen wird es uns vorgestellt und nicht selten sogar als das Werk gehandelt, das den Beginn der Romantik einläutete.
Der blonde Eckbert
Wir lesen von einem kinderlosen Paar, das zurückgezogen im Harz lebt. Wir lesen vom Ritter Eckbert und seiner Frau Bertha. Von Zweien, die nur gelegentlich Besuch von Walther erhalten, seinerseits ein Ritter, mit dem Eckbert eng befreundet ist. Eines Abends, als dieser wieder einmal in ihrem kleinen Schloss zu Gast ist, fordert Eckbert seine Frau auf, ihm die Geschichte ihrer Jugend zu erzählen. Eckbert vermutet, es würde eine Freundschaft noch mehr festigen, lege man sich offen, enthülle man all seine Geheimnisse. Bertha folgt dieser Aufforderung und beginnt am Feuer des Kamins ihre Geschichte mit den Worten:
… haltet meine Erzählung für kein Märchen, so sonderbar sie auch klingen mag.
Es folgt eine Binnenerzählung, die Schilderung von Berthas Jugend. Sie erzählt, wie sie ihren Eltern zu nichts nutze war, da sie über keinerlei Fertigkeiten verfügte, die ihrer bettelarmen Familie Geld ins Haus gebracht hätten. Wie ihr Vater, ein Hirte, sie dafür tadelte und bestrafte. Weshalb sie es eines Tages nicht mehr aushielt und im Alter von acht Jahren in die Welt floh, durch Wälder, felsige Landschaften und Dörfer, bis sie in einen Wald gelangte, in dem sie einer alten Frau mit Krückstock begegnet, die sie mit in ihre Hütte nimmt, in der sie mit einem Hund und einem Vogel zusammenlebt. Die Alte unterweist sie im Führen des Haushalts, der Versorgung der Tiere und im Spinnen. Auch lehrt sie Bertha das Lesen. Zwar kommt sie Bertha immer wieder sonderbar vor, doch es geht ihr gut bei ihr. Und auch ihr wunderschöner Vogel ist ein seltener, da er Eier legen, in denen sich Perlen oder Edelsteine befinden, und ein Lied singen kann, das wie folgt lautet:
Waldeinsamkeit, Die mich erfreut, So morgen wie heut In ewger Zeit, O wie mich freut Waldeinsamkeit.
Tag um Tag, Jahr um Jahr vergeht in dieser trauten Einsamkeit des kleinen Familienzirkels. Die Alte, die immer häufiger tagelang unterwegs ist, nennt sie mittlerweile Tochter oder Kind. Von der Fremde in den Büchern angestachelt, keimt in dem Mädchen der Wunsch, sich die Perlen und Edelsteine zu nehmen und in die Welt zu ziehen, obgleich sie sich glücklich unter diesem Dach vorfindet. Auch phantasiert sie von einem schönen Ritter, den sie sich als den ihren erträumt. Ihre Quasimutter warnte sie noch mit den Worten: „Du bist brav, mein Kind! … wenn du so fortfährst, wird es dir auch immer gut gehn: aber nie gedeiht es, wenn man von der rechten Bahn abweicht, die Strafe folgt nach, wenn auch noch so spät.“ Doch es hilft nichts, Bertha bindet den Hund fest, nimmt sich ein paar der Edelsteine, wie auch den Käfig samt Vogel und verlässt, sechs Jahre später, das Haus. Sie irrt durch Wälder, lässt Berge hinter sich, leidet Hunger und reut, gelangt jedoch nach einiger Zeit in ihr altes Dorf. Freudig will sie ihren einstigen Eltern nun den Reichtum bringen, den sie erbeutet hat, jedoch wird ihr mitgeteilt, dass diese bereits gestorben sind. Traurig darüber kauft sie sich in einer Stadt ein kleines Haus mit Garten und eine Bedienstete. Mehr und mehr vergisst sie die Alte und auch der Name des Hundes, den sie so oft gerufen hatte, will ihr überhaupt nicht mehr einfallen. Als der Vogel jedoch eines Tages wieder anhebt zu singen, ist es das Lied von einst, allerdings verändert:
Waldeinsamkeit Wie liegst du weit! O dich gereut Einst mit der Zeit. – Ach einzge Freud Waldeinsamkeit!
Bertha reut ihre Entscheidung, weggegangen zu sein, endgültig. Die Gegenwart des Vogels ängstigt sie nun, da er auch sein Köpfchen immer zu ihr dreht, und so drückt sie ihm kurzerhand die Kehle zu und begräbt ihn im Garten. Aber auch die Aufwärterin wird ihr nun verdächtig, sie fürchtet, sie könne sie irgendwann ausrauben und ermorden. Bertha heiratet einen Ritter, den sie schon einige Zeit kennt. Es ist Eckbert.
Walther bedankt sich für diese Geschichte und merkt an, dass er sich Bertha mit dem seltsamen Vogel gut vorstellen könne und wie sie den kleinen Strohmian füttert. Beide gehen zu Bett. Nur Eckbert geht in seinem Zimmer auf und ab, und fragt sich, ob sein Freund sie nun verachtet. Jede Handlung, jeder Ausdruck Walthers, der am nächsten Tag das Schloss verlässt, ist ihm von diesem Zeitpunkt an suspekt. Bertha, die seit der Nacht krank im Bett liegt, bestätigt ihren Mann in seinen Zweifeln, indem sie ihn darauf hinweist, dass Walther den Namen des Hundes wusste, der ihr längst nicht mehr einfiel. Woraufhin Eckbert, von seinem Wahn geplagt, seinem Freund einige Zeit später im Wald beim Sammeln von Moos begegnet und ihn mit einer Armbrust erschießt. Als er zum Schloss zurückkehrt, ist seine Frau bereits verstorben. Vor lauter Einsamkeit, die ihn erwartet, bereut Eckbert seine Tat und versucht sich durch Besuche von Festen ein wenig abzulenken. So lernt er den Ritter Hugo kennen, mit dem er bald eine enge Freundschaft pflegt, wie er sie auch mit Walther hatte. Wieder verspürt er das Gefühl, sich seinem Freund öffnen zu müssen. Und er tut es, obwohl ihm unwohl dabei ist. Er erzählt ihm die ganze Geschichte, von Bertha und von Walther, und dass er ihn getötet hat. Hugo spricht ihm zu, doch Eckbert fühlt sich an Walther erinnert, erkennt von da ab auch in Hugos Verhalten das ablehnende und hämische seines ehemaligen Freundes. Wut und Entsetzen packen ihn, weshalb er flieht und nach vielen Irrwegen wieder nach Hause findet. Halb wahnsinnig und von entsetzlichen Gedanken geplagt, die ihm das Rätsel der Geschehnisse nicht enthüllen, beschließt er zu Pferd eine Reise zu machen, um sich wieder ordnen zu können. Ziellos irrt er durch die Lande, findet sich in einem Gewinde von Felsen wieder, bis er endlich einen alten Bauern trifft, der ihm einen Weg hinaus zeigt. Und auch bei diesem bildet sich Eckbert ein, es könne Walther gewesen sein, da er seine Münzen, die er ihm zum Dank geben wollte, ausschlug. Durch Wiesen und Wälder reitet er sein Pferd zugrunde, setzt seinen Weg zu Fuß fort, bis er träumend einen Hügel hinaufsteigt, von dem aus er ein Bellen vernimmt, wie auch ein Säuseln der Birken. Ein Lied mit wunderlichen Tönen dringt an sein Ohr:
Waldeinsamkeit Mich wieder freut, Mir geschieht kein Leid, Hier wohnt kein Neid, Von neuem mich freut Waldeinsamkeit.
Eckbert glaubt sich nun endgültig wahnsinnig. Er weiß nicht ob er träumt oder wacht, kann das Rätsel nicht lösen. Gibt es Bertha überhaupt? Seine Erinnerungen sind keine zuverlässige Quelle mehr. Hustend schleicht die Alte mit ihrer Krücke dem Hügel entgegen. „Bringst du mir meinen Vogel? Meine Perlen? Meinen Hund?“, schreit sie Eckbert entgegen. „Siehe, das Unrecht bestraft sich selbst: Niemand als ich war dein Freund Walther, dein Hugo.“ Der Ritter erkennt seine entsetzliche Einsamkeit. Die alte Hexe fügt hinzu: „Und Bertha war deine Schwester. Warum verließ sie mich tückisch? Sonst hätte sich alles gut und schön geendet, ihre Probezeit war ja schon vorüber. Sie war die Tochter eines Ritters, die er bei einem Hirten erziehn ließ, die Tochter deines Vaters.“ Eckbert liegt am Boden, ruft: „Warum hab ich diesen schrecklichen Gedanken immer geahndet?“ „Weil du in früher Jugend deinen Vater einst davon erzählen hörtest; er durfte seiner Frau wegen diese Tochter nicht bei sich erziehn lassen, denn sie war von einem andern Weibe“, gibt sie ihm zur Antwort. Eckbert stirbt unter den Worten der Alten, dem Bellen des Hundes, während der Vogel sein Lied wiederholt.
Tieck, der Wald und die Waldeinsamkeit
Tieck, der als junger Mann noch unter den Fahnen der Aufklärung schrieb, versuchte bald, als Ergebnis eines inneren Aufbruchs, sein Werk unter dem Anspruch eines neuen hohen Ideals keimen und entstehen zu lassen. Und wie wir wissen, gelang es ihm. Von allen gelesen, beeinflusste er vehement das Denken und Schreiben, ganz allgemein die Kunst seiner Kollegen. Durch seine Bearbeitung der alten deutschen Volksbücher und -märchen (etwas, das den Aufklärern nicht im geringsten einfiel, da sie diese dem irrationalen Aberglauben zuordneten) versuchte er nicht nur Gedächtnisse von Jahrhunderten zu bewahren, sondern mehrte auch sein Wissen über die Lebensweisen der damaligen Zeiten.
Mit
Der blonde Eckbert präsentiert er typische Motive der Romantik. Die Sehnsucht, das Geheimnisvolle, der Abgrund und das Grauen sind allgegenwärtig in diesem Kunstmärchen. Der Wald, der in seinen Werken den wichtigstigsten Akteur stellt, dient ihm hier, wie auch in vielen anderen Märchen und Novellen, als subjektive Seelenlandschaft, die – anders in seiner Lyrik – häufig dunkel und dämonisch durchtränkt ist. Dennoch erfahren wir hier die Protagonisten des Waldes (die Bäume) auch als schwärmerische, säuselnde und verzaubernde. Und so ist der Wald bei Tieck nicht einfach dem städtischen Leben gegenüberzustellen, obgleich er doch, wie in dieser Geschichte, eine sehr eigene und individuelle Existenz nachzuzeichnen vermag. Was nicht verwundert, bedenkt man, dass Tieck selbst das Stadtleben sehr genossen hat, konnte er doch, vor allem in den Großstädten, mit Gleich- und Andersgesinnten über die Künste diskutieren. Pantheistisch und traumkonnotiert sind Tiecks Wälder. Denkt man bei Klopstock vor allem an Eichen, sind es hier die Birken, die verführen. Und so tritt Bertha mit dem Verlassen ihres Elternhauses in eine Sphäre des Magischen und Schicksalhaften ein (das typisch romantische Wanderschaftsmotiv wird hierbei vom Hänsel-und-Gretel-Motiv eingeleitet). Doch was lernt sie, und später auch Eckbert, kennen? Ist es die Natur ihres Wesens, oder ist es das Wesen der Natur, zu dem auch sie zu zählen sind? Klar ist: Die Emphase des in ihr Wandelnden wird ihr, der Natur, auszudrücken zugedacht. Daher sind es auch keine Naturlandschaften, die wir da draußen so vorfinden würden, würden wir sie mit den vorkommenden abzugleichen versuchen.
Die wilden Felsen traten immer weiter hinter uns zurück, wir gingen über eine angenehme Wiese, und dann durch einen ziemlich langen Wald. Als wir heraustraten, ging die Sonne gerade unter, und ich werde den Anblick und die Empfindung dieses Abends nie vergessen. In das sanfteste Rot und Gold war alles verschmolzen, die Bäume standen mit ihren Wipfeln in der Abendröte, und über den Feldern lag der entzückende Schein, die Wälder und die Blätter der Bäume standen still, der reine Himmel sah aus wie ein aufgeschlossenes Paradies, und das Rieseln der Quellen und von Zeit zu Zeit das Flüstern der Bäume tönte durch die heitre Stille wie in wehmütiger Freude. Meine junge Seele bekam jetzt zuerst eine Ahndung von der Welt und ihren Begebenheiten.
Die Idealisierung des Waldes, die den, im Zuge der Modernisierung, damalig häufig gepflanzten Nadelholzmonokulturen entgegensteht, erschafft dem Menschen einen sog. locus amoenus (hier das Birkental mit der Hütte der Alten), der ihm zum Idyll, zu einer Sehnsuchtslandschaft sondergleichen wird. Der von Tieck geprägte Begriff der „Waldeinsamkeit“ erfährt mit diesem Naturmärchen an großer Bekanntheit. Weitere mit der Natur verschränkte Wortschöpfungen folgen, wie z.B. die „Bergeinsamkeit“.
Schicksal und Inzest
Der umherirrende Mensch, der durch den locus terribilis (hier besonders die Felsenlandschaften) flieht, der bald nicht mehr weiß, wie ihm geschieht, der nicht weiß, ob er träumt oder längst dem Wahnsinn anheimgefallen ist, dient vielleicht sogar der Natur als Projektionsfläche, die ihn träumt, die sich an ihm und durch ihn vollzieht. Denkbar, nehme ich das Inzestmotiv in Augenschein, das mir am Ende den frühen erzählerischen Sog dieser Geschichte erklärt, die wir selbst als Geschichte in einer Geschichte erfahren. Denn beide, Bertha wie auch Eckbert, sind fortwährend damit beschäftigt, ihre Geschichte einem Nächsten zu erzählen, in der Hoffnung, Verständnis für ihr Handeln zu erfahren, das ihnen selbst weitestgehend unerklärlich und schicksalhaft bleibt. Gehuldigt wird damit dem sog. Freundschaftskult, der ganz besonders den Romantikern ein Begriff war. Naiv und unschuldig sind die beiden gezeichnet, trotz ihrer moralisch verwerflichen Handlungen. An das Gute glaubend, auf Erfüllung hoffend, öffnen sie sich der Welt und ihren Gästen.
Doch sogleich sie dies tun, gewinnt der Zweifel die dunkle Oberhand. Ihr einsames Glück scheint sofort bedroht. Schuldgefühle, wie die von Bertha, da sie die Alte beraubt und verlassen hatte, werden an die Oberfläche gespült. Auch scheinen beide seit je her ihr dunkles Schicksal zu ahnen. Bertha, die mit Beendigung ihrer Jugendgeschichte und dem Wiedereinsetzen der Rahmenhandlung erkrankt, stirbt sogar an ihren Schuldgefühlen, die sie zuvor lange verdrängt hatte. Walther wird zum Verhängnis, dass er Bertha gegenüber äußert, er könne sich gut vorstellen, wie sie den kleinen
Strohmian füttert. Die Nennung des Namen des Hundes (der Hund als Treuemotiv), den sie lange vergessen hatte, erschüttert sie in ihrer Sicherheit. Woher konnte Walther ihn wissen? Eckbert, der daraufhin seinen Freund im Wald mit einer Armbrust tötet, will ihn bald in jeder ihm begegnenden Person wiedererkennen, so auch in Hugo und dem alten Bauern. Ähnlich wie Bertha einst, verlässt er sein Heim und irrt durch die Lande und Wälder.
Bis er, sich seiner Wahrnehmung nicht mehr sicher, zu dem Hügel gelangt, auf dem Bertha einst stand und auf ihr neues Zuhause herabblickte. Schreiend kommt ihm die Alte entgegen, die nach ihren Tieren und Edelsteinen ruft, nach Bertha und warum sie sie so tückisch verlassen hat. Ein die Seele terrorisierender Horror, bedenkt man, dass, während sie auf ihn einspricht und ihm die Wahrheit über Berthas Herkunft verkündet, der Hund bellt und der Vogel (der Vogel als Seelenmotiv) sein Lied singt. Eine klangliche Zuspitzung, die der malerischen dramaturgisch in die Hände spielt. Was seiner Frau einst eine Idylle war, ist Eckbert düster und todbringend. Als müsse das Unheil ihrer Liebe gesühnt werden. Als hätte es niemals unter einem guten Stern stehen können, obwohl sich beide tief verbunden zueinander fühlten, ihr eigenes Idyll, seit ihrer Begegnung und Heirat, leben konnten. Als wären sie Adam und Eva in ihrem Paradies gewesen, das ihnen, aufgrund dessen, dass sie Halbgeschwister waren, nicht zugedacht war. Und doch bleibt zu fragen, ob es nicht genau deshalb eines auf Zeit sein konnte, da die Liebe, die Natur ihren Willen forderte, beide zueinanderfinden ließ. Die Alte, die Eckbert gegen Ende wie eine Rachegöttin entgegentritt, erinnert stark an eine Erd- und Totengöttin wie Hel eine ist. Sesshaftigkeit verlangte sie von dem Mädchen, nicht vom Wege abzukommen riet sie ihr, statt vom Fernweh getrieben neugierig in die Welt zu treten, da sich sonst ein Unheil vollziehen würde. Prophetisch wurde das Heim als heiler Ort von ihr verkündet, als eine Idylle, in der der Mensch keinen Versehr erfährt, solange er sich der Neugier verweigert, passiv bleibt, die Dinge geschehen lässt, ohne sie selbst aktiv in die Hand zu nehmen.
Verstörend und enorm sehnsuchtsvoll ist dieses Horrormärchen, das die Grenze zwischen Wahn und Realität, Traum und Wirklichkeit auf eine dunkle, tief schauerliche Weise verwischt. Hell und inniglich sind mir die beiden Hauptprotagonisten, Eckbert und Bertha (die sich auch namentlich ähneln), dennoch in ihrem Bestreben glücklich zu sein, die Welt im Kleinen an ihrer Geschichte teilhaben zu lassen, auch wenn dies nicht gelingt. Ein psychologisch herausragener Stoff, der dem Wahnsinn ganz eigene kraftvolle Landschaften wirkt, unter deren Oberflächen sich Dunkles verbirgt: eine blinde Natur, die sich im Menschen offenbart, der die Natur seines eigenen Willens entwickelt. Ein zeitlos mystischer Horror, der zeigt, wie unergründlich und unhintergehbar unser Dasein ist.