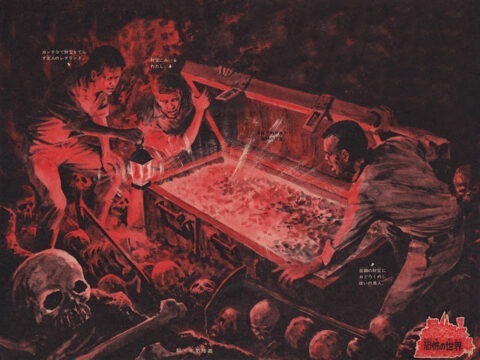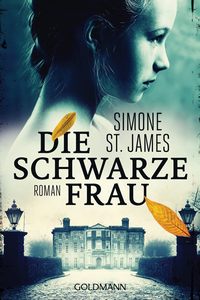Dem Autor Alan Moore, dem „Zauberer” hinter „V wie Vendetta”, „Batman: The Killing Joke”, „From Hell” und vielen anderen Titeln, ist es gelungen, seine zeitgenössischen Ideen auf revolutionäre Weise durch das Medium Comic zu vermitteln. Indem er sich mit universellen Konzepten auseinandersetzte und sie durch Symbolismus und Satire aufschlüsselte, erregte er schnell die Aufmerksamkeit der Welt. Er wurde zu einem wichtigen Einfluss in der Populärkultur, denn sein Werk besitzt bis heute eine unvergleichliche Relevanz für die moderne Politik und Philosophie. Zu seinen bedeutendsten Comics gehört das mit dem Hugo Award ausgezeichnete Hauptwerk „Watchmen”, das mit seiner Erzählung, seinen Themen, seinen Figuren und seiner philosophischen Botschaft die Comic-Industrie schlagartig veränderte.
Die Geschichte von „Watchmen” ist in einer alternativen Realität angesiedelt, die sich am Zustand der Welt in den 1980er Jahren orientiert. Sie ist ein ausladender Kommentar zum Superheldenkonzept und seinen persönlichen sowie politischen Implikationen vor dem Hintergrund eines drohenden Atomkriegs. Zwar absolviert Richard Nixon hier mehrere Amtszeiten als Präsident der Vereinigten Staaten und die Vereinigten Staaten gewinnen den Vietnamkrieg, doch die zentrale Wendung dieser realistisch dargestellten Geschichte ist die Existenz von Superhelden und ihre Verantwortung für die Entwicklung der internationalen Beziehungen und die Verbrechensbekämpfung. Während die Spannung ins Unermessliche steigt, deutet der Mord an einem ehemaligen Helden auf ein größeres Komplott hin. Aufgrund des Keene-Gesetzes sind Vigilanten nun illegal und ihre Aktivitäten sind untersagt.
Alan Moore hat sich eines Themas angenommen und eine realistische und doch nihilistische Sicht auf Superhelden vorgelegt, wie es sie vorher noch nie gegeben hat. Durch seine vielschichtige, nicht-lineare Erzählweise bietet er eine intime und doch universelle Geschichte, die den Wahnsinn der Welt durch die Augen von Vigilanten betrachtet. Diese haben ihre Bestimmung in Handlungen gefunden, die darauf ausgerichtet sind, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen. Ob diese Helden für die Regierung arbeiteten oder nicht, war nicht entscheidend für das Verständnis der keineswegs neuen Erkenntnis, dass die Menschheit zu Schrecken jenseits unserer Vorstellungskraft fähig ist. Anhand verschiedener komplexer Charaktere – vom schwer fassbaren, zwanghaften Rorschach bis hin zum göttlichen, rätselhaften und introspektiven Dr. Manhattan – wird in einer zwölfteiligen Serie ein kritischer Kommentar zur Motivation von Helden präsentiert.
Die schonungslose Sezierung der Superhelden und die fesselnde Krimihandlung sind jedoch nicht die einzigen Eigenschaften dieses Comics. Zeichner Dave Gibbons verdient ebenso viel Lob für dieses bahnbrechende Werk, denn sein Neun-Panel-Raster ist eines der ikonischsten Elemente dieser Geschichte. Die dialoglosen Seiten zeigen eine unglaubliche emotionale Bandbreite und bestätigen das Sprichwort, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Der ehrgeizige und selbstbewusste Künstler zögert nicht, die Hauptfiguren zu ignorieren und sich auf die Umgebung zu konzentrieren, um die starke Symbolik der Geschichte zu vermitteln. Tatsächlich gibt es in der gesamten Geschichte erstaunliche Wort- und Bildspiele, die bis ins kleinste Detail analysiert werden können und die Erzählung meisterhaft perfektionieren. Dies hilft auch bei der Illustration einiger der besten Übergänge zwischen den Panels. Letztendlich dient das Artwork als tadelloses Gefäß, um diese erschütternde und doch fesselnde Tragödie zu erzählen, die auf ihrer selbst konstruierten, atemberaubenden Mythologie aufruht.
Dieses Buch wurde seit seiner Erstveröffentlichung endlos zerpflückt. Jedes Bild wurde mikroskopisch genau untersucht, die Handlung, die Charaktere und die Symbole wurden nicht weniger ausführlich analysiert als jene der Odyssee. Die Fans dieses Buches sind wie die Fans aller anderen Bücher auch äußerst einnehmend und streitlustig. Wenn man ein Buch wie dieses zum ersten Mal liest, wird man wahrscheinlich weniger Kritik üben, sondern eher eine intellektuelle Angleichung vornehmen. Was gesagt werden konnte, wurde wahrscheinlich schon gesagt; die Frage ist nun, mit wem man übereinstimmt.
„Watchmen“ ist groß, wichtig, brillant – und unerträglich. Es ist mythisch, düster. Es ist fantastisch und dumm. Auf seinen Seiten gibt es Helden, Antihelden und riesige, blaugesprenkelte Superhelden. Es gibt Aliens, straßenkämpfende Lesben und Piraten. Zweideutig böse Genies und durchschnittliche New Yorker sind ebenfalls dabei. Wenn die Gewalt nicht intim ist, dann ist sie global. Wenn der Sex nicht zärtlich ist, dann ist er schmutzig. Die Geschichte von „Watchmen” ist zum Teil ein Krimi, zum Teil ein philosophisches Traktat. Der Schreibstil ist heftig, bahnbrechend, verkniffen und pedantisch. Die Kunst ist stets steif, aber immer angemessen.
Watchmen ist alles. Manchmal ist es sogar langweilig.
Obwohl „Watchmen“ als bahnbrechende Graphic Novel bezeichnet wird, lässt sich die Frage, was eine Graphic Novel ist, kaum klären. Das Time Magazine hat ihn zu einem der 100 besten Romane des Jahrhunderts gekürt. Dabei ist „Graphic Novel“ einfach das Etikett der Wahl für diejenigen, die lieber nicht beim Lesen von Comics erwischt werden wollen.
Eine der wichtigsten Figuren ist Dreiberg. Er ist kein Held mit Superkräften, aber auch nicht ganz gewöhnlich. Er ist ein Post-Superheld: Seit die Regierung maskierte Verbrechensbekämpfer verboten hat, hängt sein Nite-Owl-Kostüm im Schrank und sein cooles Luftkissenfahrzeug verstaubt im Keller. Aufgrund seines Übergewichts ist sein Selbstvertrauen geschwächt, sodass er sich nur aus der Ferne für Dr. Manhattans kurvige Freundin Laurie begeistern kann. Dr. Manhattan steht außerhalb der Zeit. Als Opfer eines nuklearen Unfalls kann er über Wasser laufen, durch Wände gehen und in einem Anfall von Wut sogar zum Mars fliehen und dort schmollen. Die Geschichte beginnt jedoch mit Rorschach im Trenchcoat – einsilbig und vermutlich geisteskrank – und seiner Vermutung, dass jemand es auf die Maskierten abgesehen hat. Während sich Recht und Unrecht um ihn herum ständig verschieben, ist Rorschach ironischerweise derjenige, der konstant bleibt. Er ist das schreckliche Gewissen von „Watchmen“.
Die Handlung ist komplex und äußerst anspielungsreich. Neben der Haupthandlung gibt es mehrere Hintergrundgeschichten sowie eine alternative Geschichte, die sich im Hintergrund abspielt. Es gibt Darstellungen und Parodien auf die unterschiedlichsten Medien: Comics, Zeitungen, Fernsehen, Werbung, Zeitschriftenartikel usw. Zudem gibt es endlose Verweise auf die jüngere amerikanische Geschichte, die Antike, Philosophie, Poesie, populäre Musik, andere Comics und „Watchmen“ selbst.
Die verschiedenen Symbole des Comics – Uhren, Pyramiden und Dreiecke, das berühmte blutbespritzte Smiley-Gesicht, Masken, Tintenkleckse, Vögel und Schmetterlinge, Atome, Parfüm, Knoten, Spiegel und Reflexionen u.v.a.m. – wirken dagegen fast schon konkurrenzlos unsubtil. Pyramid Deliveries. Prometheus Cab Company. Gordian Knot Lock Co. Nostalgie-Parfüm. Utopia Theater.
Einige Handlungselemente wirken überflüssig und einen Schritt zu gewollt. An erster Stelle steht der Piratencomic im Comic. Die Tatsache, dass die Piraten die Superhelden als Thema der Comics abgelöst haben, deutet darauf hin, dass die Welt der „Watchmen” vielleicht düsterer und weniger idealistisch ist als unsere eigene. (Zumindest ist sie düsterer als die Zeit, in der Superhelden die Comics beherrschten.) Doch was ist mit einer Welt, in der Comics wie „Watchmen” dominieren? Moore übertreibt es jedoch, indem er ein morbides Piratenabenteuer einführt, das während der gesamten „Watchmen”-Geschichte Parallelen und Kommentare zur Haupterzählung aufweist. Zunächst ist es ein netter Trick, doch wenn es Kapitel für Kapitel wieder auftaucht, fragt sich der Leser: Was soll das?!? Der Autor des Piratencomics taucht sogar in einer Nebenhandlung auf, hat aber kaum Wirkung.
Die Grafik ist selbstbewusst, manchmal jedoch auch übermäßig konservativ: Die Kiefer sind quadratisch, die Seiten sind stets in neun Panels unterteilt. Das Ergebnis ist eine interessante formale Spannung zwischen einem altmodischen Look und bahnbrechenden Texten. Eine komplizierte Handlung und ein ausgeklügeltes Layout greifen ineinander wie – was sonst? – ein Uhrwerk. Das ist auf technischer Ebene interessant. Es gibt jedoch Momente, in denen sich alles sehr nach der Maschinerie des Plots anfühlt. Dadurch verliert die Geschichte an Leben.
Es wird deutlich mehr Zeit auf die Figuren als auf die Geschichte verwendet. Das ist ein weiteres Indiz dafür, warum „Graphic Novel” als Etikett funktionieren könnte – wenn man dazu geneigt ist. Charaktere wie Dan Dreiberg, Laurie Juspeczyk und ihre Mutter Sally Jupiter sind allesamt erkennbar menschlich und äußerst dreidimensional dargestellt. In ihrer Welt ist alles kompliziert, ironisch und unangenehm.
Was Rorschach, Dr. Manhattan und den von Alexander besessenen Geschäftsmann Ozymandias betrifft, hätte man sich in einer anderen literarischen Inkarnation vorstellen können, dass sie einen langen, erholsamen Spaziergang vor dem Internationalen Sanatorium Berghof gemacht hätten, während sie mit ihren Stöcken klickten und über die Auswirkungen des Determinismus nachdachten. Leider werden sie in „Watchmen“ auf die ganze Erde und sogar auf den Mars losgelassen. Sie sind kaum mehr als mythisch-philosophische Typen mit gequältem Vokabular. Sie schweben über unserer bloßen Sympathie oder Empörung.
Ein weiteres Problem bei „Watchmen” ist die Wirkung, die der Comic auf das Medium selbst und sein Publikum hatte. Die Comicfirmen haben aus „Watchmen” die falsche Lektion gelernt. Anstatt neue Wege zu finden, um bekannte Geschichten zu erzählen, dachten die Autoren und Künstler im Grunde, dass die Gewalt und die „Reife” dafür verantwortlich waren, dass „Watchmen” so beliebt war. „Reife” bedeutet jedoch mehr als nur Blut und unanständige Worte. Das wusste „Watchmen”, seine Nachahmer in den Jahren danach jedoch nicht. Anstatt dem Beispiel von „Watchmen” mit seiner Tiefe, seinem sozialen Kommentar und der Art und Weise, wie es das Medium nutzt, zu folgen, wurden die Comics einfach nur düsterer statt komplexer. Das hat die Comics verändert – jedoch nicht immer zum Besseren.
„Watchmen“ ist durchweg ernsthaft und äußerst ehrgeizig. Es ist groß und strebt danach, wichtig zu sein, aber zu oft ist es einfach nur selbstgefällig. Moores Texte strotzen nur so vor Überheblichkeit und werden von Zeit zu Zeit zu einer Parodie ihrer selbst.
In „Watchmen“ gibt es einen herzzerreißenden Moment. Er ereignet sich am Ende des vorletzten Kapitels, wenn der Videomonitor weiß wird und alles entsetzlich still ist. Dieser Moment ist wie geschaffen für einen Mythos, für eine Geschichte, in der es um das Unbekannte geht, um das, wofür wir zunächst keine Worte haben. Der Mythos blickt in das Herz einer großen Stille. Bemerkenswert an „Watchmen“ ist die Art und Weise, wie methodisch und manchmal grausam die „essentielle Albernheit” seiner Charaktere entlarvt wird (um Moore in seinem Vorwort zu The Dark Knight Returns zu zitieren), während gleichzeitig der Geist und die Mission des Mythos aufrechterhalten werden.
Und das, obwohl Mythen und Romane, oder Comics und Romane, traditionell ein Widerspruch in sich sind. Sicher, Mythen mögen sich manchmal wie Romane lesen, aber die beiden Formen haben eigentlich nichts gemeinsam. Selbst die experimentellsten Fiktionen müssen sich bis zu einem gewissen Grad auf psychologischen Realismus stützen; ohne ihn wären ihre Figuren unerkennbar und ihre Handlungen uninteressant. In den Mythen hingegen geht es genau um dieses Widersprüchliche und das Unerklärliche. Das Leere. Das Schweigen.
Letztendlich überwiegt jedoch die visuelle Komplexität von „Watchmen“ viele seiner literarischen Schwächen. Es ist interessant anzuschauen. Und die Welt, die Alan Moore erschaffen hat, ist so umfassend und tiefgründig erdacht, dass sie einen in ihren Bann zieht und am Ende nicht mehr loslässt.